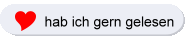Veröffentlicht: 09.12.2024. Rubrik: Unsortiert
Knecht Ruprecht darf nicht sterben – eine etwas andere Weihnachtsgeschichte
Der Tannenbaum in der Ecke des Saals, ein Gebirge aus Lichterglanz und Lametta, sah aus, als wollte er durch die Decke wachsen, um ein Dutzend festlich geschmückte Tische herum warteten drei Dutzend Erwachsene und Kinder mit vor Erwartung geröteten Gesichtern.
Jemand klopfte schwer an die Tür, ein schwarzer Kerl mit struppigen Haaren und im zottigen Kleid erschien, in der einen Faust eine Rute aus Birkenreisig, in der anderen einen Knotenstock, auf dem Rücken einen prallen Sack. Meine Mutter schob mich vor, ich begann vorzutragen, was ich in den letzten Tagen mühsam auswendig gelernt hatte, das ganze Gedicht, fehlerfrei:
Von drauß, vom Walde, komm ich her,
ich muss euch sagen, es weihnachtet sehr . . .
Bei den letzten Zeilen jedoch
Nun sprecht, wie ich's hier innen find!
sind's gute Kind, sind's böse Kind?
kam ich leicht ins Schwanken, und fast hätte ich mich versprochen, denn die Augen, mit denen mich der finstere Knecht bei meinen Vortrag angesehen hatte, kamen mir bekannt vor, sehr bekannt sogar. Und als er jetzt auch noch mit seine Rute herumwedelte und fragte, bist du denn auch immer schön artig gewesen, erkannte ich ihn an der Stimme: Der finstere Kerl war Onkel Rudi, der Bruder meiner Mutter.
Bisher hatte ich weder vor dem struppigen Kerl noch vor seiner Rute Angst gehabt, dafür war sein Gehabe zu übertrieben. Mich interessierte auch nicht, warum seine Stiefel blitzblank waren, wenn er doch von weit her kam, und dann noch aus dem Wald, wo erfahrungsgemäß doch reichlich Unrat herumliegt, und warum der Schnee auf seinen Schultern in diesem überheizten Raum nicht taute. Ich hatte ihn angestarrt wie ein Wesen aus einer anderen Welt, und meine Fantasie schlug Purzelbäume. Aber Onkel Rudi hatte nicht einmal seine Stimme verstellt, und damit war das Geheimnisvolle, das all die Jahre von dieser seltsamen Erscheinung ausgegangen war, verflogen. Bisher hatte ich keine Fragen gestellt und „artig“ hingenommen, was die Erwachsenen erzählten. Dass er von weit herkam und ein Diener des Nikolaus sei, dieser Knecht Ruprecht, der früher, in alten Zeiten, unartige Kinder in den Sack steckte und dem Teufel zum Fraß vorwarf. Dass der Nikolaus dagegen ein guter Mann sei und artige Kinder belohne. Schon da ahnte ich, obwohl ich es nicht hätte begründen können, dass es mit Gut und Böse so seine Bewandtnis hat. Wieso waren in meinen Stiefeln am Nikolaustag genau so viele Süßigkeiten wie in den Stiefeln meines Bruders, den ich doch manchmal bis aufs Blut triezte. Ich hätte ihn gerne danach gefragt, diesen Nikolaus, doch er zeigte sich nie, und meine Mutter meinte, er habe keine Zeit, sich um alle Stiefel zu kümmern.
Zum ersten Mal glaubte ich ihr nicht. Wieso war er denn da gewesen und hatte unsere Stiefel gefüllt? Also hat er doch Zeit gehabt! Außerdem, ein Spukgeist, der keine Zeit hat? Und schon kamen mir weitere Bedenken. Wenn in dem Knecht Ruprecht der Onkel Rudi steckt, überlegte ich weiter, wer steckt dann im Weihnachtsmann? Der Weihnachtsmann war für mich immer eine Lichterscheinung gewesen, eine Art Heiliger, der meine Wünsche (meistens) erhörte und erfüllte, und den ich schon Wochen vor dem Fest mit schwärmerischer Ungeduld erwartete. Dann war also auch der nichts anderes als ein, allerdings, freundlicher Kinderschreck, denn auch er trat mit einer Rute auf und fragte mich, ob ich auch schön „artig“ gewesen sei. Dieses Wort habe ich mittlerweile aus meinem Wortschatz verbannt, obwohl es sich immer noch im Sprachgebrauch hält. Warum müssen Kinder „artig“ sein, wo doch die Welt unartig ist. Auf der weihnachtlichen Schulfeier meines Enkelsohnes neulich war es wieder da, dieses Wort – prall und fett wie ein vollgefressener Kater. „Kinder, seid ihr auch schön artig gewesen?“, fragte die „Jahresendfigur mit Silberbart“ – die meisten Kinder riefen „Ja!“, nur eines rief „Nein!“. Am liebsten wäre ich aufgestanden und gegangen, doch diese eine Nein!, hielt mich davon ab, einen Skandal zu verursachen, und ich blieb zähneknirschend sitzen. Denn es gab mir die Gewissheit, dass auf neunundneunzig weiße Schafe ein schwarzes kommt, das die weißen vor dem Wolf warnt.
In jener Zeit meiner Vertreibung aus dem Kinderparadies mit seinen Geheimnissen, mit seinen Kontinenten der Fantasie, mit dem tiefen Erstaunen über die faszinierenden Erscheinungen der Natur, platzte eines Tages die Nachricht, Onkel Rudi habe einen Herzinfarkt erlitten und liege im Krankenhaus, wir sollten schnell kommen, ehe es zu spät sei. Wir fuhren sofort hin. Der Onkel lag da, klein und grau wie ein aus dem Nest gefallenes Küken, Schläuche hingen aus Mund und Nase wie wirre Krakenarme. Auf einmal erfasste ich ein nie gekannter Schauer. Nicht wegen des Anblicks des Onkels. Ähnliches hatte ich schon einmal gesehen, vor einem Jahr, als der Großvater väterlicherseits auf dem Totenbett lag, schwer von Asthma geschüttelt. Doch nicht die furchtbaren Geräusche waren es, die mich so erschüttert hatten. Es war die schwarze Standuhr gewesen, die stehen geblieben war. Ihr unbewegtes Pendel hatte mir Entsetzen eingeflößt. Wie oft hatte mich ihr wilder Bronzeschlag in vibrierende Erregung versetzt, urzeitliche Welten mit urzeitlichen Klängen heraufbeschworen aus urzeitlichen Instrumenten. Doch nun stand die Uhr still, angehalten von der Großmutter, und kurze Zeit danach war auch der Großvater still.
Doch Onkel Rudi lebte noch, wenn auch sein Leben am seidenen Faden hing. Und wieder stand Knecht Ruprecht vor mir, hörte ihn mit seiner unglaubhaft sanften Stimme fragen: „Na, bist du denn auch immer schön artig gewesen?“, hörte mich „Ja!“, sagen, und auf einmal erfasste mich eine unbändige Sehnsucht nach dieser alten, von allen Zweifeln unbeschwerten Zeit. Ich warf mich über sein Bett, suchte seine Hand und rief: „Knecht Ruprecht darf nicht sterben!“
 4x
4x