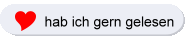Veröffentlicht: 23.08.2024. Rubrik: Unsortiert
Hundeflüsterer
In der Welt der Haushunde bin ich eine feste Größe. Erstaunlich für jemanden, der viele Jahre lang panische Angst vor Hunden hatte; ich litt seit einer Hundeattacke in meiner Kindheit unter einer Angststörung. Als ich diese Phobie überwunden hatte, wurde ich auf Ratschlag meines Psychotherapeuten zu einem Hundetherapeuten. Ausgerechnet! Er sah dieses in mir, und ich stieg zunächst zögernd in die Materie ein, fand dort aber bald darauf die Erfüllung. Mein Spezialgebiet: Schwierige Fälle, Hunde, die ohne erkennbare Warnung zugebissen hatten, und denen niemand mehr vertraute. Und ich fand stets eine Lösung, entdeckte immer ein ruhiges Wesen unter dem aggressiven Zorn der Tiere. Unglaublich, ich wurde zu einem erfolgreichen Hundeflüsterer. Bis zu dem Tag, an dem ich 'Ihm' begegnete.
Er war ein attraktiver Rüde, ein komplett schwarzer Schäferhund, dessen Augen im Dunkeln leuchteten wie die Glut eines erlöschenden Feuers. Sein Besitzer, ein Eigenbrötler aus der Vorstadt, kam auf Empfehlung eines Freundes. Der Problemhund hatte bereits mehrere Menschen schwer verletzt. Ich wäre seine letzte Hoffnung, sagte der verzweifelte Mann - ich nahm die Herausforderung an. Die ersten Tage verliefen wie alle ähnlich gelagerten Fälle. Mit Geduld und Geschick gelang es mir, das Vertrauen des Tieres zu gewinnen, ein extrem intensives Unterfangen. Doch etwas fühlte sich anders an, ein unterschwelliges Unbehagen beschlich mich jedes Mal, sobald ich mich von meinem 'Patienten' entfernte. Ich spürte dann ein Unwohlsein, ein bedrückendes Gefühl, fast als würde mir die Luft zum Atmen genommen. Und nachts träumte ich von endlosen, dunklen Gängen, in denen ein tiefes Knurren widerhallte. Ich ignorierte den Traum, ich schrieb ihn dem Stress zu und arbeitete mit dem Hund wie gewohnt weiter.
Schon nach einigen Wochen zeigte der schwarze Schäferhund gute Fortschritte. Er hörte auf meine Kommandos, seine Aggressivität nahm spürbar ab. An diesem Punkt war ich zufrieden mit meiner Arbeit. Aber dieser Zustand war nicht von Dauer, denn bald ereigneten sich schreckliche Vorfälle unter den anderen Tieren meiner Hundeschule. Zuerst war es ein kleiner Foxterrier, den ich seit Monaten zwischenzeitlich betreut hatte: Ohne Vorwarnung biss er seine Besitzerin ins Gesicht, als sie ihm sein Futter gab. Dann ein belgischer Hütehund, der ein Kind, das er bis kurz vorher liebevoll beschützt hatte, plötzlich anfiel und schwer verletzte. Ähnlich gelagerte Fälle häuften sich in meinem Institut. Meine Methoden, einst gefeiert und allseits bewundert, schienen nun meine Schützlinge in Monster zu verwandeln. Verzweifelt versuchte ich, herauszufinden, was ich falsch machte. Hatte sich ein gravierender Fehler in mein Training eingeschlichen? Ich fand keine Erklärung. Das nachhaltige Grübeln hatte mich verunsichert. Ich spürte, irgend etwas in meinem Inneren nagte an mir, das sich im Anschluss an jede Trainingseinheit mit dem glutäugigen schwarzen Hund verstärkte. Als dieser schließlich so weit war, zu seinem Besitzer zurückzukehren, war ich erschöpft, aber hochzufrieden. In der Nacht nach seiner Rückführung hatte ich einen Traum, der sich völlig anders anfühlte als meine früheren, ich kannte vorher keine Alpträume. In diesem befand ich in einem Wald, und um mich herum waren die Schatten zahlloser Hunde, ihre Augen glühten wie die von dem dunklen Schäferhund. Ein tiefes, grollendes Knurren drang aus ihren Kehlen zu mir, es klang wie Stimmen, die aus allen Richtungen gleichzeitig sprachen.
Ich wachte schweißgebadet auf, völlig verwirrt. Und ich verspürte auch keine Erleichterung, als ich aus dem Bett stieg. In diesem Gemütszustand ging ich ins Bad und sah in den Spiegel, ich traute meinen Augen kaum: Ich schien in ein Augenpaar zu blicken, das wie jenes des schwarzen Hundes funkelte. Dann war der Spuk vorbei. Doch eines blieb, ich therapiere keine schwarzen Hunde mehr.
 3x
3x