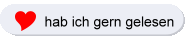Veröffentlicht: 08.11.2024. Rubrik: Unsortiert
Endstation
Die letzten 100 km bis nach Santiago de Compostela teile ich mir ein, fast schon genussvoll. Auf dem Weg von der französischen Grenze bis hierher habe ich mir physisch, vor allem aber mental, die erhoffte Robustheit erwandert, ich kann das Tempo frei einteilen, und innehalten, wann immer ich es möchte. Im letzten Ort vor Santiago, die Kathedrale des Pilgerziels ist von hier aus schon gut zu erkennen, verweile ich für zwei Tage. Anders als bei etlichen Hardcore-Pilgern spielte der religiöse Aspekt für mich unterwegs keine Rolle, ich bin den Jakobsweg ausschließlich in selbst-therapeutischer Absicht gegangen.
So war das Ziel dieses Weges ohne spirituelle Bedeutung für mich, es ist einfach nur der Endpunkt eines strukturierten Marsches, der mich aus einem desolaten Zustand herausholen sollte. Ich lebte vorher schon längere Zeit in einem antriebsschwachen Modus, mit morgendlich aufwallenden depressiven Verstimmungen, kurz gesagt, das Leben entglitt mir, wurde dysfunktional. Fachärztliche Hilfe war zeitnah nicht verfügbar. Was blieb, war eine hausärztliche Verordnung von Tranquilizern, die mir ursächlich nicht halfen, sondern nur eine kurzzeitige Wurstigkeit aufkommen ließen. Nun also meine selbstgewählte therapeutische Maßnahme, sie ist erfolgreich verlaufen, ich kann voller Zufriedenheit meine Rückreise planen - per Flieger nach Deutschland. Auf den in Santiago zu erwartenden Rummel kann ich verzichten, dennoch, der Gedanke, am Schlusspunkt dieser Reise angekommen zu sein, stimmt mich wehmütig, und ich beschließe, weitere Zeit hier im Lande zu verbringen. Bei einem Glas Wein, das erste seit vielen Wochen, gehen meine Erinnerungen an einen Urlaub in meinen Jugendtagen zurück. Ich verbrachte seinerzeit unvergessene Tage unweit von Bilbao. Farbenfrohe Bilder aus unbeschwerten Tagen steigen in mir auf, besonders von den altsteinzeitlichen Höhlenmalereien im Städtchen Altamira im spanischen Baskenland. Ich fasse einen Entschluss, dort will ich hin, an den Ort reisen, an den ich mich nun intensiv erinnere.
Am darauffolgenden Tag besteige ich den Zug in Richtung Norden. Alleine der Blick aus dem Abteilfenster auf den nahen Atlantik, und auf der anderen Seite der zu den Gipfeln des kantabrischen Gebirges – einfach grandios. Ich bin auf einem guten Weg. Am Abend dann nur noch wenige Kilometer bis zur Endstation. Von hier aus werde ich das finale Teilstück am nächsten Tag per Bus zurücklegen.
Nach dem letzten Tunnel, die Einfahrt in den Sackbahnhof des Zielbahnhofs. Die Szenerie wirkt bei einsetzender Dunkelheit auf mich, wie das Hineintasten in einen unbekannten Raum, der von Schatten durchzogen ist, als ob das Dunkle die Kontrolle übernimmt. Im spärlichen Restlicht der wenigen Straßenlaternen werde ich zunehmend verunsichert, verstärkt durch die schleichende Dunkelheit an den Rändern des Bahnhofs. Die Silhouetten der Waggons und Lagerschuppen verschwimmen, gleichzeitig dehnt sich die Finsternis aus. Die metallisch kreischenden Geräusche des Bremsvorgangs auf den Schienen tun ein Übriges. Ich spüre, die Kontrolle über meine Wahrnehmungen zu verlieren, mich überkommt ein bedrückendes Unbehagen, dazu das Gefühl einer Brustenge: Jeder Atemzug wird zur Herausforderung. Und doch weiß ich, da ist nichts gegenständlich Gefährliches. Es sind Symbole vom Boden des Unbewussten, die mich in diesem Zustand festhalten, dem ich physisch nicht entfliehen kann. Ich bin gezwungen auszuharren, mich gegen diesen düsteren Nebel zu stemmen, mich auf meine neuerworbene mentale Stärke besinnen. Mein Blick sucht verzweifelt einen Fixpunkt, und findet ein schwaches Licht am anderen Ufer der Bucht, auf das ich mich konzentriere.
 3x
3x