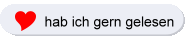Veröffentlicht: 27.06.2023. Rubrik: Persönliches
Sommersonnentag
Zum ersten Mal alleine weg von daheim, so weit weg, bis in die Bretagne, uns erschien es wie eine Weltreise.
Unsere Eltern kannten das gar nicht. Viel zu viel hatten sie uns einpacken lassen, eine jede schleppte zwei große Koffer mit sich. Als der D-Zug aus dem Hauptbahnhof auslief, rannte Emilies Vati die ersten Meter neben unserem Eisenbahnwagen her, hilflos winkend. Gerührt waren unsere Alten, den Tränen nahe; wahrscheinlich weil innerlich und unbewusst das Trauma ihrer Flucht aus Schlesien mitschwang. Wir dagegen waren aufgeregt.
Bei mir hatte sich neben dem unvermeidlichen Reisefieber eine unbändige Freude eingestellt, endlich eine gute Freundin gefunden zu haben, die so ein Abenteuer mit mir wagte. Was für ein Glück, was für ein unglaubliches Freiheitsgefühl! Die ganze Nacht hindurch ratterten die Waggons über die Gleise, zweimal hieß es umsteigen, in Paris den Bahnhof wechseln, bis wir endlich in Antrain ankamen, ein malerisches, bretonisches Kaff aus altem, steinigen Gemäuer. Sogleich rief abends meine Mutter an, plärrte aus Leibeskräften in den Telefonhörer wegen der weiten Entfernung, auf deutsch natürlich, ob wir heil angekommen wären; aber natürlich waren wir das.
Einfach so hätten wir nicht verreisen dürfen, doch unser modern eingestellter, einfühlsam freundlicher Französischlehrer, Herr Maurice, hatte erfasst, wie übermäßig umsorgt wir Hascherln waren, oder doch eher, wie eingesperrt, daheim in unserem Elternhaus mit jeweils einem eingezäunten Garten rundum, und hatte es geschafft, uns aufzustacheln, sogar so sehr, dass wir diesen unseren ersten Trip zu Hause auch durchsetzen konnten. Zu einer Jugendleiterausbildung hieß er uns anmelden, zu recht von der Notwendigkeit davon überzeugt, wollten wir doch Lehrerinnen werden, im Leben unsere Frau stehen.
Unter lauter Franzosen waren wir gelandet; wie schön, einmal ein ganz anderes Umfeld zu entdecken. Als ich beim Vorstellen meinen Namen Stachlhuber laut aussprach, prusteten alle los; wegen des Gezischels, habe ich mir später erklären lassen. Die anstrengende Reise saß mir anfangs noch in den Gliedern, ließ mich „Ich bin müde“ in großen Buchstaben auf das vor mir liegende Blatt malen. Diesen Satz konnten sie am Ende der zehn Tage alle korrekt aussprechen, zudem konnten sie das 'Rrrrr' sie alle rollen entgegen der Behauptung, Franzosen könnten dieses nicht artikulieren. Ob es daran lag, dass Emilie ein kräftiges, bayerisches 'R' auch im Französichen sprach? Nicht einmal später als Französischlehrerin konnte sie es sich abgewöhnen, es wurde zu ihrer persönlichen Note. Außerdem konnten die Franzleute ausnahmslos ja doch ein bisschen Deutsch, was sie so in der Schule gelernt hatten.
Nicht wenige waren freilich schon in Deutschland gewesen, einer von ihnen mit seiner Handballmannschaft sogar in meiner Nähe, in Obertraubling. Schön war er, dieser junge Mann, dunkelhaarig und groß, feinfühlig mit leuchtenden Augen, wenn er mich ansah. Wenn ich ehrlich bin, hatte ich an den Bernard im Laufe der Jahre trotz aller Verzauberung kaum mehr gedacht, aber erst neulich hat Emilie mich, neidisch neckend, daran erinnert, wie wir doch am letzten Abend unseres unvergesslichen Aufenthalts mit mehreren im Nachtdunklen einen Spaziergang gemacht hatten. Nur wegen mir hatte Bernard uns angestiftet durchs mitternächtliche Dorf zu schlendern, an der alten Mühle vorbei, weil ich mich vor den anderen nicht getraut hatte, ihn zu küssen. Hinter den Auen an der Mühle zog sich die Gruppe dann auseinander, so waren wir zwei für uns alleine. Er legte den Arm um mich, fand es reizvoll, dass ich noch so unerfahren war, und küsste mich: „C'est un baiser, pas un bisou (d.h. eindeutig ein Kuss, kein Bussi)“, raunte er mir liebevoll ins Ohr, „damit du nicht ungeküsst durch Leben gehen musst.“ Ja, romantisch war es, sehr sogar. In meinem Inneren sind diese fröhlichen, unbefangenen Sommertage, nie ganz verblasst, ausgelassen, beschwingt und verliebt, wie ich war. In dieser Stimmung fuhren wir dem Meer entgegen, das wir noch nie gesehen hatten.
Eigentlich hätten wir heimfahren sollen, aber es gab eben einen verlockenden Wegweiser vor der Haustüre nach St.Malo, der imposanten Stadt am Atlantik, nur zwanzig Kilometer entfernt, des Weiteren eine Buslinie bis dorthin. Es war Sommer, die Sonne schien. Unsere französischen Freunde ermunterten uns, doch nicht so dumm zu sein, und nach Hause zu fahren, wo wir doch nur einen Katzensprung vom Meer entfernt waren. Recht hatten sie.
Also fuhren wir Richtung Meer. Irgendwann sah man rechter Hand nichts mehr, als sandigen Schlamm; keine Bäume, keine Sträucher, kein Gras. „Ist das das Meer?“, staunte ich. „Ja, das wird's wohl sein“, bekam ich von Emilie zur Antwort, die meine Begeisterung nicht so ganz teilte. Sie wäre lieber brav, ihren Eltern gehorchend, auf direktem Weg zurückgefahren, was meiner Verzückung jedoch keinen Abbruch tat. Spätabends, als wir auf der Kaimauer entlang flanierten, kam das Meer, besser gesagt, die ungebändigte Flut, spritzte über die Kaimauer, dass die Gischt nur so schäumte, wild und tosend, für uns überraschend. Es war ein heißer Sommersonnentag gewesen, deshalb machte es nichts aus, dass uns das Nass uns anspritzte, die Abfrischung war uns willkommen.
Ich werde diesen Sommertag immer als großartiges Erlebnis in Erinnerung behalten, genauso wie meine Freundin ihre Besorgnis, dass wir damals zu spät bei der Jugendherberge angekommen sind; ihre Türen waren verschlossen. Irgendein Tourist kam indessen des Weges, hatte sich den Schlüssel geben lassen, sodass wir doch noch reingekommen sind. Mein lachendes „Es ist ja nicht passiert.“ hat sie nie verstehen können, ebenso wenig wie meine grenzenlose Freude am tosenden Meer, meine mir innewohnende Lebensfreude.
 3x
3x