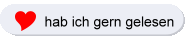Veröffentlicht: 24.03.2025. Rubrik: Nachdenkliches
Die Landpartie
Landpartie
Mein Freund bewohnt ein altes Bauernhaus nahe einer kleinen Stadt auf dem Land hinter den Bergen. Sein ganzes Leben lang war er von Ort zu Ort gezogen, hat mal hier gearbeitet, mal dort, mal dies, mal jenes. Jetzt ist er in dem Alter, in dem andere in Rente gehen, und so hat er mit dem Geldverdienen aufgehört und ist zurück in das ererbte Elternhaus an den Ort seiner Kindheit gezogen. Der neue Lebensabschnitt soll gefeiert werden, also hat er sie alle eingeladen: die Nachbarn, die Freunde aus der Schule und dem Studium, die Geschwister und deren Angehörige. Auch mich, der ich aus dem Rheintal über den Vogesenkamm hinweg anreise.
Das Haus, in dem er nun wohnt, ist langgezogen, in der Mitte eine Toreinfahrt, durch die man auf die dahinterliegende Weide kommt. Denn das war sie einmal, diese riesige Wiese, die sich vor mir entfaltet, die Weide der Schafe seines Vaters, deren Stall sich im Erdgeschoss der einen Hälfte des Hauses unter dem Heuboden befand. In der anderen waren Werkstatt und Wohnung. Das Haus ist renovierungsbedürftig. Mein Freund möchte alles selbst machen. Ich wünsche ihm ein langes Leben bei guter Gesundheit.
Mein Freund ist ein Lebenskünstler. Das war er immer schon gewesen. Ein liebenswerter Chaot mit umfassenden Fähigkeiten, wenn es darum geht, Menschen für ein Produkt oder eine Idee zu gewinnen. Auch dieses kleine Fest zu Beginn seines Ruhestandes zeugt von dieser Begabung.
Ich komme recht früh. Er hat gesagt, man träfe sich so ab sechzehn Uhr. Ich vermute richtig, komme erst eine Stunde später, und doch sind erst eine Handvoll Gäste da. Bei Zeitangaben ist er großzügig.
Ich wohne in der Großstadt, schon mein ganzes Leben lang. Ich bin also Städter. Mein Freund ist ein Mann vom Land. Er denkt anders als ich, er lebt anders als ich, er stellt andere Ansprüche ans Leben als ich. Umgekehrt ist es genauso.
Sein Haus habe ich gefunden. Meinen Wagen soll ich an beliebiger Stelle auf der großen Wiese abstellen. Da sei auch ein Hinweisschild. Richtig. Ein großes „P“ weist mich hinter das Haus. Neben dem „P“ deutlich erkennbar gezeichnet ein Schaf. Denn er wolle ein Schaf braten, hat er allen gesagt, die er eingeladen hat. Er würde sich um das Fleisch kümmern, die Gäste sollten Vorspeise, Salat oder Dessert mitbringen.
Er scheint mit vielen Gästen zu rechnen, denn auf seiner Wiese, eingerahmt von den einige Meter langen Holzstapeln für den Ofen, stehen eine Reihe Bänke. Bänke, wie sie für meinen Freund typisch sind. Selbstgemachte Bänke. Zwei gleich hohe Teile eines Baumstammes, darüber ein Brett genagelt, zwei Querlatten zur Versteifung, fertig. Genauso die Tische. Alles in wenigen Minuten zusammengezimmert, zweckmäßig, schlicht, und ohne Probleme einer Zweitverwertung als Brennholz zuzuführen.
In einer großen Plastikwanne mit Wasser liegen die Bierflaschen; der Weißwein und die Säfte sind in einem Kühlschrank; der Sirup und die Schnäpse stehen auf einem der Tische; die zum Grill umgebaute Regentonne nimmt einen prominenten Platz ein. Ein selbst gemaltes Schild „WC“ weist zwischen zwei Holzstapeln, die Lücke ist mit einer blauen Plastikplane verschließbar. Ich kann mir nicht vorstellen, dass das „W“ seine Berechtigung hat.
Nun, denke ich mir, so kann man es auch machen. Er macht es anders, als ich es machen würde. Wenn ich Gäste auf meiner Terrasse empfange, sind die Stühle mit Kissen versehen, die Teller gedeckt, das Besteck liegt am rechten Fleck, die Servietten stecken in den Wassergläsern, in der Farbe passend zur Tischdecke. Tischkultur eben. Das Bier und der Wein kommen aus dem Kühlschrank. Das „WC“ trägt sein „W“ zu Recht. Und: Bei mir müssen die Gäste nichts mitbringen.
Bei meinem Freund tun sie es. Alle bringen etwas mit und stellen es in eine Ecke. Gegessen wird später.
Inzwischen sind sie da, die Gäste. So um die vierzig. Der Platz reicht kaum. Man stellt sich einander vor, klärt die Beziehung zum Gastgeber, überlegt, wo man sich schon einmal getroffen haben könnte, redet über alte Bekannte oder die immer noch ungelösten Probleme in der kleinen Stadt, an deren Rand sie wohnen.
Mein Freund möchte uns seine Wohnung zeigen. Wir stapfen durch das hohe Gras an den wild rankenden Tomaten beim verfallenen Schafstall vorbei auf die Durchfahrt des Hauses zu. Dort duftet es nach Werkstatt: alte Arbeitskleidung, Öl, Benzin. Berge von Arbeitsschuhen. Die Wände voller Werkzeuge, vermutlich Jahrzehnte nicht mehr gebraucht, geraume Zeit vor dem Tod des Vaters meines Freundes in den Ruhestand versetzt. Er führt uns eine gewendelte Stiege hinauf in sein Reich. Wieder eine Werkstatt: der Flur. Zwei Stufen geht es in den kleinen, fein eingerichteten Schlafraum hinunter. Dann ein Herd, ein paar Schränke. Das mit Kiefernholz getäfelte Wohnzimmer, ein Tisch, ein Sessel, ein Schaukelstuhl. Die Wände voller Bücher. Es sieht gemütlich aus unter den schräg verlaufenden Dachsparren. Wie bei Spitzwegs armen Poeten. Das Dach scheint jedoch dicht zu sein. Ein alter, gusseiserner Ofen. Ob der im Winter reicht? Hinter einer Holzwand abgeteilt, unter der Schräge, ein Waschbecken, eine Badewanne, hinter einer dünnen Tür ohne Schloss eine Kompostier-Toilette. Nun verstehe ich, warum die Tomaten so üppig wachsen. Ich werde nachdenklich. Der ökologische Fußabdruck meines Freundes ist deutlich kleiner als der meine. Ob ich so leben könnte?
Es dunkelt und noch immer ist von dem Schaf nichts zu sehen. Da holen zwei seiner Freunde Glut aus dem kleinen Feuer, das schon seit Stunden brennt, werfen sie in die Tonne und stapeln Holzscheite darauf. Das Feuer lodert auf. Ein Grillrost wird aufgelegt.
Der Bruder meines Freundes hat einige hundert Schafe, wie ich erfahre. Eines davon hat er für uns geschlachtet und zerlegt. Es ist in dem blutigen Plastiksack, der jetzt auf einen Tisch gelegt wird.
Die Salate finden ihren Platz auf dem Tisch in der Mitte des von den Bänken gesäumten Platzes. Zehn Salate, nur zwei Salatbestecke, die dann von Schüssel zu Schüssel wandern. Kleine Stücke einer Quiche werden herumgereicht, eine Flasche Wein wird geöffnet, Plastikteller und Besteck werden verteilt. Die ersten Teile des Schafes werden auf den Grill gelegt, immer wieder mit Wasser abgelöscht, damit sie nicht verbrennen. Nach wenigen Minuten geht einer der beiden am Grill mit den ersten kleinen Fleischstücken herum. Sie schmecken einfach köstlich.
Es ist dunkel geworden. Kerzen werden aufgestellt, Schwedenfeuer entfacht. Man geht herum, jeder scheint mit jedem zu reden, die Seidenbluse mit dem verwaschenen Hoodie, Designerjeans mit Jogginghose, Strohhut mit Baseballkap, Perlenkette mit Wolfszahn-Schmuck. Bekannte und Unbekannte im Gespräch. Manchen hilft der Alkohol, sich zu öffnen. Der junge Mann an meiner Seite rückt nach dem dritten Glas Wodka-Orange freundlich näher. Da ist etwas, das alle miteinander verbindet. Es ist mein Freund.
Einer von den Alten holt sein Akkordeon heraus und spielt die Lieder, die sie alle kennen. Ich mache mich auf den Heimweg. Ich bin zutiefst dankbar und erfüllt. Es sind noch drei Stunden zu fahren. Im Wald bremse ich für die drei jungen Wildschweine, Fuchs und Reh grüßen vom Straßenrand, die Katze verschwindet hinter einem Holzstoß. Ich überquere die Passstraße und komme langsam zurück in meine Welt.
 4x
4x