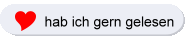Veröffentlicht: 14.11.2022. Rubrik: Unsortiert
Simon
Simon.
von
Bernhard Montua
Ich hatte diesen Job, auf der Leuchtturminsel, einer Annonce entnommen und bekam die Zusage sehr schnell. Die Ermahnungen, dass es sehr einsam werden würde und niemand sagen könne, wie diese Einsamkeit auf mich wirken würde, schob ich beiseite. Was sollte schon sein. Okay, es würde kein Internet geben, aber ich nahm viele Bücher mit. Genug zu Essen und Trinken würde ich auch haben. Das kleine Schiff brachte mich auf die Winzige Insel mit dem hohen, rot, weiß gestrichenen Leuchtturm. Die Fahrt mit dem Boot dauerte nur ungefähr eine halbe Stunde. Das Eilland- maß in der Länge Fünfhundeartmeter und war in der Breite eben so lang. Die Sonne schien, sie spiegelte sich in den großen, von der Brandung rundgeschliffenen. schwarzen Steinen. Weiße Wolken trieben am blauen Himmel vorbei. Auf der Insel wuchsen keine Grasbüschel noch wuchs ein Busch oder Baum. Es war ein trostloser Steinhaufen im Meer. Ein kleiner, kalter Schauer lief mir über den Rücken, als ich diesen unwirklichen Ort das erste Mal betrat. Ich machte die kühle Brise, die mir ins Gesicht blies, dafür verantwortlich, die Luft roch nach Salz, Fisch und Meerestank.
Nachdem ich die Vorräte von dem Schiff geholt und sie im Turm verstaut hatte, verabschiedete sich der Kapitän mit den Worten:
»Dann bis in drei Monaten und alles Gute«. Ich winkte ihm, bis das Schiff außer Sichtweite war, noch lange zu.
Anschließend nahm ich die Insel und den Turm in genaueren Augenschein. Der Turm war gute dreißig Meter hoch und 100 Jahre alt. Die rote und weiße Farbe beblätterte an vielen Stellen ab, der Turm benötigte dringend einen neuen Anstich. Er hatte vier Stockwerke, wobei das Vierte die Leuchtanlage beherbergte. Um das Oberste Stockwerk lief ein schmaler Gang, der mit einem Geländer gesichert war. Diese Anlage musste ich 24 Stunden im Auge behalten. Dazu gehörte Spiegel putzen und defekte Lampen auswechseln. Das Putzen war eine tägliche Aufgabe, das Leuchtmittel wechseln, nur nach Bedarf. Alles in allem ein problemloser Job.
Ich war nach dem langen Tag müde und ich ging früh in dass schmale, an eine Schiffskoje erinnerndes Bett, welches sich im 2.Stock, am Fenster der runden Wohnstube befand. Der Ausblick auf das Meer war atemberaubend. Weiterhin befand sich in der Stube, ein kleiner Schreibtisch, nebst einem Stuhl, einem alten Sessel, einer Kommode sowie einem alten, schiefen Schrank. Den Möbeln sah und roch man ihr Alter an. Aber ich achte auf all das nicht, während ich im Bett lag und die Federdecke mit dem geblümten Bettbezug bis zum Kinn hochzog, ich hörte nur auf das Rauschen des Meeres, das durch die kleinen Fenster drang, und war nach sehr kurzer Zeit eingeschlafen. Ich träumte in dieser Nacht von großen, blauen und gelben Fischen, mit denen ich um die Wette schwamm. Ich war ein Teil des Schwarms. Das fröhliche Treiben endete plötzlich, als ein Wal auftauchte und einen großen Teil des Schwarms verschlang. Ich befand mich mit meinen Artgenossen, in totaler Dunkelheit, im Bauch des Wals. Es roch nach verwestem Fisch und altem Seetank. Eigentlich hätte ich Angst verspüren müssen, tat es aber nicht. Der Wal hatte das Maul zu weit aufgerissen, so dass nicht alle Fische in seinen Magen passten und ich und einige andere, meiner Artgenossen, aus seinem Magen heraus schwimmen konnten. Wir beeilten uns, den geflüchteten Schwarm einzuholen. Wir schafften es und schwammen mit dem Schwarm ungerührt weiter. Am Ende des Traums wachte ich auf und schaute in den makellosen blauen Himmel, der durch das kleine Fenster in die Stube leuchtete. Ich verfolgte eine kleine, weiße Wolke, die am Himmel vorbei trieb mit den Augen. Danach stand ich auf und ging die Wendeltreppe hinunter, in die Küche, wo ich mir einen Tee und einen Toast mit Erdbeermarmelade zu bereitete. Ich nahm beides und ging in den obersten Stock und trank den Tee, während ich auf das unendliche Meer schaute. Das Wetter war klar und man konnte bis zum Horizont sehen, es gab nur Horizonte ringsherum. Kein Schiff, kein Land war auszumachen. Nur das Meer schwappte unermüdlich an die runden Steine.
Dann trat, nach drei Wochen, Linda in mein Leben. Sie surrte um die Krümel meines Frühstücks herum und ich, freute mich riesig über ihren Besuch. Sie musste mit dem Proviant vom Festland gekommen sein. Sie war bloß eine kleine Fliege, aber ich sah in ihr das lebendige Wesen und sie vermittelte mir das Gefühl, das ich nicht alleine war, in dieser lebensfeindlichen Umgebung, die nur aus endlosem Wasser und einem winzigen Steinhaufen bestand. Wir waren in wenigen Tagen beim Du. Bei den Mahlzeiten saß sie auf meinem Unterarm, das kitzelte zu Beginn ein wenig, aber ich gewöhnte mich nach kurzer Zeit daran, ja ich genoss es sogar. Ich erzählte ihr von meinen Ängsten, Sorgen und Plänen für die Zukunft. Linda sah mich mit ihren rötlichen Fassetten Augen interessiert an, und schwieg. Hin und wieder flog sie weg, summte herum, um nach wenigen Minuten zurück zukommen. Und ich konnte meinen Monolog fortsetzen. Dank des Zuckerwassers und den anderen leckeren Essensresten wuchs Linda zu stolzen acht Millimetern heran. Wir wurden ein freundschaftliches Paar. Es kam leider der Morgen, als Linda im Anflug auf ihr heißgeliebtes Zuckerwasser stoppte und rücklings ins Wasser fiel und verstarb. Ich war traurig und betroffen. Ich fühlte mich wie damals, als mich Maria verlassen hatte. Die ersten Tage waren mit Trauer erfüllt. Da nach keimte bei mir die Hoffnung, dass Linda vielleicht eine Larve hinterlassen hätte und ich mich mit ihren Nachkommen anfreunden könnte. Aber ich wurde enttäuscht. Ich dachte wieder an Maria und an die E-Mail, die sie mir nach drei Jahren zum Abschied geschrieben hatte. Ich ziehe nach Berlin, manches gut, unsere Zeit war nett. Die Wut und die Trauer spürte ich noch wie damals in mir. Ich sagte mir es ist eine neue Zeit und überhaupt, das Leben musste weiter gehen. Und das Leben ging weiter. Ich stürzte mich auf die Bücher und meine Tätigkeit auf dem Leuchtturm. Vierzehn Tage lang herrschte klares Wetter, und ich begann mich an den endlosen Himmel, und das mich umgebene uferlose Wasser zu gewöhnen. Dann kam der Nebel, der so dicht wurde, dass ich kaum zwei Meter weit sehen konnte. Ich fühlte mich wie lebendig begraben unter dieser nassen Wattewand. Aus dieser grauen Wand drangen undeutliche Stimmen, die ich nicht vermochte zu verstehen. Ich kroch in mein klammes feuchtes Bett und versuchte einzuschlafen. Nach Stunden gelang mir das auch. Danach kamen die Träume. Die so grauenhaft waren, das ich mich nicht mehr traute ins Bett zugehen. Ich setzte mich in den Sessel und schaute aus dem kleinen Fenster nach draußen. Nur da war nichts, außer dem undurchdringlichem Nebel, der um den Leuchtturm waberte. So verbrachte ich mehre Nächte am Fenster, und starrte hinaus, der Schlaf überkam ich erst in den frühen Morgenstunden. Ich erwachte jedes Mal schweiß gebadet. Nach wenigen Tagen war ich mit meinen Nerven am Ende. Meine Hände zitterten meine Augen waren blutunterlaufen und meine Stimme krächzte, wen ich in selbst Gesprächen vertieft war. Danach musste ich über die wahren Gründe meines Hierseins nachdenken. Eigentlich war es kein Job, sondern eine Flucht.
Ich hatte gerade meinen neunten Mord begangen und die Pausen zwischen den Morden wurden immer kürzer, es war aber auch so leicht geworden. Ich wurde leichtsinnig und die Polizei war mir auf den Fersen, da war ein Untertauchen auf einer einsamen Insel sehr hilfreich gewesen, zumal ich auch noch einen falschen Namen bei dem Betreiber der Leuchtturminsel verwendet hatte. Ich wollte alles niederschreiben, wollte reinen Tisch machen.
Vor meinem inneren Auge sah ich, wie alles begann. In meiner Erinnerung tauchte mein alter Schulweg auf. Ich musste so sechs oder sieben Jahre alt gewesen sein und lebte in Mecklenburg, auf dem Land. Eigentlich bestand ganz Mecklenburg, zu dieser Zeit, nur aus Land. Mein Weg führte mich durch endlose wogende Weizenfelder und ich lief so schnell ich konnte an diesen, mit roten Mohnblumen und mit dunkelblauen Kornblumen bewachsen Rändern entlang. Denn in den Feldern lauerte angeblich die Kornmuhme, hatte mir meine Mutter drohend erklärt. Diese Kornmuhme sollte eine Art Hexe sein, die Jagd auf Kinder machte, die nicht brav ihre Pflichten erfüllten und ich war nicht brav. Ich war zu dieser Zeit, ein dünner, verschrobener Einzelgänger und meine Klassenkameraden machten sich einen Spaß daraus, mich zu hänseln.
Es war an einem Mittag, nach der Schule, ich hatte den größten Teil des Unterrichts verträumt und beeilte mich, um an den Weizenfeldern vorbei nach Hause zukommen, als eine schwarze Gestalt aus dem Feld trat und drohend die Arme hob. Ich hatte nur zwei Optionen, entweder Flucht oder den Kampf. Flucht, aber wohin, also Kampf. Ich klaubte einen großen Stein vom Wegrand und stürzte mich auf das Ungeheuer und drosch immer wieder auf diese Hexe ein. Der Stein traf den, unter dem Umhang verborgenen Kopf der Hexe, der Umhang verrutschte und es kam Klaus, der Anführer der Jungen, die mich in der Schule hänselten, zum Vorschein. Er lag seltsam still und verdreht vor mir auf dem Weg und ich schaute teilnahmslos auf den blutigen Körper. Ich empfand kein Mitleid oder Schuld, nein, aber ein Gefühl des Triumphs und der Befriedigung durch strömten mich, ich war glücklich. Der Junge verstarb an seinen Verletzungen und ich wurde in eine andere Schule versetzt. Die Verantwortlichen werteten das Ereignis als einen Unfall, aber in mir war die Mordlust erwacht. Ich hatte eine Bedrohung mit Gewalt überwunden und dabei ein wunderbares Gefühl gehabt. In meinem Inneren brannte der Wunsch, dieses Gefühl wieder haben zu wollen. Es sollten weitere neun Jahre der glücklosen Leere ins Land gehen, bis ich meinen zweiten und dritten Mord begehen sollte.
Mein Körper begann mit der hormonellen Umstellung zum Mann. Mein Gesicht verwandelte sich, in eine mit Pickeln übersäte Kraterlandschaft. Ich war sechzehn Jahre alt und ich betete Johanna an, die in die Parallelklasse ging. Sie war von ihrer Erscheinung bereits eine Frau und mit allen Attributen einer solchen gesegnet. Lange, Weizen blonde Haare, kornblumenblaue Augen, ihre vollen roten Lippen, erinnerten mich an den Klatschmohn am Wegesrand. Ich sah ihren nackten Körper, jede Nacht, in meinen schwülen Träumen vor mir. Aber mir fehlte der Mut, sie anzusprechen, ich begnügte mich da mit, in ihrer Nähe zu sein, und ich war immer in ihrer Nähe, auch nach der Schule verfolgte ich sie bis zum Abend. Manchmal setzte ich mich nachts unter ihr Fenster. Ich stellte mir dabei vor, wie sie leicht bekleidet in ihrem Bett lag.
Es kam der Tag des Abschiedsballs der Schule, wir sollten unser Abschlussdiplom erhalten und ins Erwachsen leben entlassen werden. Das musste gefeiert werden, mit Musik, Tanz und leckeren Speisen. Alle Eltern hatten etwas zum Fest beigetragen. Ich trug meinen besten Anzug und hielt eine große Schüssel mit Nudelsalat mit Fleischbällchen in den vor Aufregung, zittrigen Händen. Es war der dicke Dieter, aus meiner Klasse, der mich absichtlich anstieß und dabei die Nudeln, samt der Soße, auf meinen Anzug kippte. Alle lachten, ich wurde rot und schämte mich für mein besudeltes Aussehen. Am lautesten lachten Johanna und der Junge, der an ihrer Seite stand. Der Junge hieß Martin, er war ein grobschlächtiger Kerl. Sein Vater war der reichste Fuhrunternehmer am Ort und Martin protzte mit dem Geld seines Vaters. Er schmiss mit Geld nur so um sich. Martin legte wie selbstverständlich, seinen rechten Arm um Johannas nackte Schultern und führte sie auf die Tanzfläche, dabei lachten sie noch immer. Ich kochte vor Wut und Scham. Aber die Wut gab mir die Kraft auf die Tanzfläche zu stürmen und Johanna, um den nächsten Tanz zu bitten. Vor Wut und Aufregung zitterte ich am ganzen Körper. Ich berührte sie an der Schulter, sie sah mich mit kalten, spöttischen Augen an und schrie:
»Nimm die deine dreckigen Finger von mir, du pickliges Froschgesicht.« Martin knurrte wild wie gereizter Kettenhund:
«Hau ab oder ich breche dir sämtliche Knochen, du hässlicher kleiner Knirps.«
Mit weichen Knien verließ ich wie in Trance, die Tanzfläche und anschließend den Ballsaal. Ich lief in den Park, der an die Schule grenzte, setzte mich unter einen Baum und begann hemmungslos zu schluchzen. Ich fühlte mich gedemütigt und verletzt.
Es war bereits kurz vor Mitternacht, als ich aufstand, und durch den Park den Heimweg antrat. In meiner Kehle steckte immer noch ein Kloß aber ich hatte keine Tränen mehr. Da sah ich sie, in dem spärlichen Licht der Parkbeleuchtung, auf einer Bank eng umschlungen sitzen. Ich schlich mich leise von hinten an sie heran. Meine Johanna küsste Martin so voller Leidenschaft, dass mir vor Empörung, fast das Herz stehen blieb. Ich konnte mich erinnern, dass ich zu dieser Zeit immer ein großes Klappmesser bei mir trug. Ohne das Ich es mir bewusst war, griff ich nach dem Messer in meiner Jacke. Der kühle schwere Griff schmiegte sich in meine Hand. Ich schlich mich noch näher heran, ich hätte mich auch mit einem Panzer nähern können, sie hätten es nicht bemerkt, so sehr waren sie miteinander beschäftigt. Danach verschwand, die zwanzig Zentimeter lange Messerklinge, im Rücken von Martin. Ich stach noch zweimal zu, der Körper von Martin fiel wie ein nasser Sack zu Boden. Anschließend wendete ich mich Johanna zu. Mein Messer stach in ihren schlanken, weisen, weichen Hals, den ich lieber liebkost hätte, aber ich schlitzte ihn der Länge nach auf. Dabei durchtrennte ich ihre Stimmbänder, so das Sie keinen Schrei über die Lippen brachte. Sie sah mich nur mit einem stummen, entsetzten Blick an. Ich stach noch viele Male auf sie ein. Die Zeitungen berichteten später, dass es zwanzig tiefe Stiche gewesen waren. Anschließend ging ich nach Hause und schmiss, die mit Nudelsoße, Rotze und Blut beschmierten Sachen, in die Waschmaschine, und beseitigte so alle Spuren von meiner Kleidung. Alle Wut und Demütigungen waren verraucht, ich fühlte eine tiefe Genugtuung in mir, kurz gesagt, ich war zufrieden mit mir und der Welt. Natürlich gab es lange Untersuchungen, aber kein Verdacht fiel auf mich.
Ich begann eine dreijährige Ausbildung zum Buchhändler. Herr Buschmann war der Name meines Lehrherren und Besitzers der Buchhandlung am Marktplatz. Er war ein freundlicher alter Herr, der ein enormes Wissen über Literatur und Bücher besaß. Nach kurzer Zeit entwickelte sich unser Verhältnis in die eines Vaters zu seinem Sohn. Buschi, so durfte ich ihn nennen, lebte allein. Seine Frau war vor drei Jahren gestorben. Er war zweiundvierzig Jahre verheiratet gewesen. Kinder waren aus der Ehe nicht hervorgegangen. Nach Ablauf von zwei Jahren nahm mich Buschi zur Seite, und eröffnete mir, das er mich zum Erben der Buchhandlung bestimmt hätte. Das Geschäft sollte überleben und in gute Hände kommen, nur so könne sein Lebenswerk bestand haben, sagte er mir. Buschi war achtundsechzig Jahre alt, drahtig und gesund wie ein junger Hund. Ich musste also unter Umständen noch sehr lange warten, bis ich das versprochene Erbe antreten konnte. Nach Abschluss der Lehre wollte ich aber nicht noch Jahre warten, bis ich das Erbe bekommen würde.
Ich täuschte einen Einbruch in das Geschäft vor, dabei schoss ich Buschi von hinten in den Kopf, es gab kaum Blut, denn ich hatte ein kleines Kaliber gewählt. Danach nahm ich das Geld aus der Kasse und aus seinem Portemonnaie, den kostbaren Diamantring zog ich ihm vom Finger und verschwand aus dem Laden. Keiner hatte mich gesehen. Den Ring und das Portemonnaie warf ich in einem entfernten Stadtteil in den Müll, das Geld steckte ich natürlich ein. Am nächsten Morgen rief ich die Polizei und meldete den tot und den Einbruch. Alles ging glatt über die Bühne, der oder die Täter wurden nie gefunden, und ich trat mein Erbe an.
In den kommenden Monaten befiel mich ein befremdliches Gefühl. Ich empfand Reue. Ich hatte das erste Mal aus Geldgier getötet. Aber so sehr ich meine Tat auch bereute, ich konnte sie nicht ungeschehen machen. Als so lernte ich, mit meiner Schuld zu leben.
Das Leben entwickelt sich in den nächsten Jahren, mehr als gut für mich. Ich erweiterte die Buchhandlung um weiter fünf Filialen im Umkreis von einhundert Kilometern. Dadurch konnte ich größere Mengen von Büchern bei den Verlagen bestellen, mit denen ich nun selbst verhandeln konnte, und ich erzielte bessere Einkaufpreise. Mein Gewinn stieg. Aber die Arbeit stieg ebenfalls und bald ich benötigte ein Geschäftsführer. Ich lernte Günter bei einer Lesung in einer der fünf Filialen kennen und schätzen. Schnell wurden wir uns handelseinig und ich gab ihm einen Vertrag. Nach einem erfolgreichen Jahr und guter Zusammenarbeit hatte er mein Vertrauen erlangt. Ich kümmerte mich um die Geschäfte kaum noch. Ich genoss das Leben, eines vermögenden, dreißigjährigen Geschäftsmannes. An Mord dachte ich nur noch ab und an in meinen Träumen.
Der erste Hinweis kam von einem der Filialleiter, der zweite dingende Hinweis kam von meinem Buchhalter, der sagt es würden beträchtliche Summen fehlen, und er wolle das nicht mehr für sich behalten, trotz der Anweisung des Geschäftsführers. Ich sprach Dieter bei unserm nächsten Gespräch auf diesen Verdacht an. Der wies alle Vorwürfe zurück und verließ empört den Raum. Ich ordnete eine unabhängige Buchprüfung an. Diese ergab zweifelsfrei, dass ein hoher, fünfstelliger Betrag aus den letzten drei Jahren fehlte. Ich entließ Dieter sofort, dieser erhob keine Klage gegen diese Kündigung, sondern drohte mir mit Vergeltung.
Wenige Wochen später zersplitterten die Fensterscheiben in meinem Haus. Jemand hatte sie mit Steinen in der Nacht zerstört. Kurz danach wurden alle Bäume in meinen Garten durch Säure vernichtet. Ich sah mich gezwungen, einen privaten Wachdienst, zu meinem Schutz, zu beauftragen, dieser lieferte mir nach wenigen Tagen Bilder von Dieter, während er die Reifen von meinem Auto zerstach. Ich erstatte Anzeige. Dies hatte aber keinen Erfolg, da die Bilder nicht zweifelsfrei zeigten, dass diese, auf den Bilder aufgenommene Person, wirklich die Reifen zerstochen hatte.
Im Darknet heuerte ich einen Mann an, der Dieter eine Lektion erteilen sollte. Er sollte für mehre tausend Euro, Dieter die Beine brechen. Der aus Russland stammende Mann hatte den Auftrag falsch verstanden, er brach Dieter das Genick, und ich wurde am fünften Mord mit schuldig. In meinen Augen waren meine Morde bisher aus Selbstverteidigung, Rache, Eifersucht und Geldgier, sowie aus einem Versehen geschehen. Die nächsten Morde sollten zu meinem reinen Vergnügen geschehen. Ich brachte in den nächsten Jahren in verschiedenen Städten, vier Straßendirnen um, nicht weil ich sie besonders Verachtete, sondern weil sie leicht verfügbar waren. Meine Werkzeuge waren das Messer, Drahtschlingen oder einfach meine Hände. Mit neun und dreißig Jahren lernte ich Maria, bei der Eröffnung der sechsten Filiale kennen. Sie war in meinem Alter und meine erste große Liebe. Wir verbrachten drei wundervolle Jahre, und ich dachte, es würde bis an das Lebensende so weiter gehen. Maria verließ mich mit einer kurz verfassten E-Mail. Meine verzweifelte Antwort war, ich überfuhr sie mit meinem SUV. Sie flog zehn Meter durch die Luft, als sie der schwere Wagen, in dieser regen Nacht, vor ihrem Haus traf. Sie verstarb noch auf der Straße, habe ich später in der Tageszeitung gelesen. Ich verbuchte diesen Mord unter Selbstverteidigung. Das sah die Polizei natürlich anders. Sie hatte Lackspuren an Marias Leiche gefunden und ein Zeuge hatte den Größten Teil meines Autokennzeichens erkannt. Bald würden sie mich finden und lebenslang einsperren. Ein Leben hinter Gittern war keine Option für mich.
Die schwarzen Steine der kleinen Insel werden nun meinem Leben ein Ende setzen, auf die mein Körper aus dreißig Metern aufschlagen wird. Mein Selbstmord wird nun leider mein letzter Mord sein. Es grüßt ein
trauriger Simon
Ende -
2022 -
 3x
3x