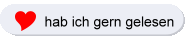Veröffentlicht: 21.06.2021. Rubrik: Persönliches
Drei Momente
In meinem Leben gibt es bisher drei Momente, in denen ich dachte: „Dieses Leben ist mühsam. Tot sein wäre angenehmer.“
Das erste Mal war in der Nacht des Tages, als mein Vater mir sagte, dass ich nutzlos sei, und mein Leben sinnlos, nichts wert. Ich war noch ein Kind. Vielleicht zwölf, oder dreizehn Jahre alt. Er wollte etwas in der Wohnung umbauen und ich war die einzige Person, die zur Stelle war. Meine Mutter war nicht anwesend und mein Bruder war, wenn ich mich richtig erinnere, aus der Wohnung geschmissen worden. Ich hatte kein Problem damit. Ich wusste, dass alles wieder in Ordnung kommen wird, kam es auch. Aber als ich zum Abbauen eines dreißig Jahre alten Schrankes nicht kompetent genug war (und nach weiteren Fehltritten beim Helfen), schrie mich mein Vater mit diesen Worten an. Ich weiß, und wusste damals schon, dass er natürlich nicht so dachte. Mein Vater ist ein guter Mann und hat stets versucht das Beste für uns zu tun, im Rahmen seines Möglichen, mehr kann man auch nicht verlangen. Aber keine Worte haben sich vermutlich so schnell und tief in meine Seele gebrannt wie diese.
Das zweite Mal war in der Nacht, als ich realisierte, dass ich meine große Liebe für immer verloren habe. Ich habe mich aufgemacht sie zu überraschen. Es war einen Monat nachdem wir uns getrennt hatten. Ich habe ihre Sachen gesammelt, ein Buch zusammengestellt, mit Fotos von uns beiden, zusammen mit schön bemalten Texten und Sprüchen, warum ich sie nicht verlieren möchte. Es war eine spontane Idee sie zu besuchen, sodass ich noch in ihrer Stadt morgens in einem Café saß, um das Buch so perfekt wie möglich zu gestalten und in eine wunderschöne cremefarbene Box, umbunden von einer schokoladenbraunen Schleife zu verpacken.
Sie war nicht Zuhause.
Ich war darauf vorbereitet, habe ihrem Vater darum gebeten ihr zu sagen, dass Buch so schnell wie möglich zu öffnen, denn auf der letzten Seite stand, dass ich auf ihre Antwort im Park nebenan warten würde. Ich wartete bis Mitternacht, und das zweite Mal kam.
Beim dritten Mal war ich stark angetrunken. Ein Freund und ich haben uns zum Cocktailtrinken verabredet. Zum Zeitpunkt hatte ich sie schon verloren, ich arbeitete vor mich hin, das Studium nahm ich nicht mehr wahr. Jeden Tag schlurfte ich auf einem Weg, dessen Ziel am Ende auch mit einem Sprung hätte erreicht werden können. Der Freund erzählte mir von seinen Problemen, natürlich ohne zu wissen, was in mir vorging, und ich konnte es nicht mehr ertragen. Ich habe es ihm auch gesagt.
Er hat gelacht.
*
Wenn man solche Gedanken hat, romantisiert man gerne seinen eigenen Tod. Man stellt sich vor, was passieren würde. Wer alles zur Beerdigung kommen würde, um über eine Person zu weinen von der man immer dachte sie sei das Selbstbewusstsein in Person. Man stellt sich vor, was die Menschen denken werden, ob sie sich die Schuld geben, dass sie es nicht früher erkannt haben, dass man viel mehr Zeit mit einem hätte verbringen müssen, und nicht nur dann, wenn man einen seelischen Mülleimer braucht.
Solche Gedanken . . . warum zieht man sie also nicht durch? Ist es die Angst vor einem Schmerz? Die Hoffnung, dass alles wieder besser wird? Oder vielleicht die Unwissenheit vor dem, was danach passiert. Wir wissen nicht, was nach dem Tod passiert. Aber eines kann ich sagen das passieren wird: Die Leute die uns lieben, werden uns vermissen. Sie werden Schmerzen durchleben, die man selbst dann nicht mehr fühlen kann. Und genau diese Schmerzen, die ich ebenfalls durch meinen Tod verursachen würde, bringen in mir ein Schuldgefühl hervor, dass mich daran hindert auch nur einen Schritt weiter in diese Dunkelheit zu gehen.
Doch jeder dieser drei Momente, hat etwas in mir in Gang gesetzt, dass einerseits ein erneutes Aufkommen verhindert, andererseits die Barriere des Nicht-Tuns auch abschwächt. Denn jedes Mal wurde meine Bindung zu Dingen und Personen schwächer. Ich diagnostiziere mich selbst hin und wieder mal aus Spaß als Soziopathen. Warum sollte ich es nicht dürfen, schließlich habe ich das Thema studiert. Was definiert einen Soziopathen? Nun, da sind sich die Geister noch nicht einig. Aber Kriterien beinhalten das Fehlen vieler Bindungen (anders als beim Psychopathen, welcher sich an nichts binden kann), das Fehlen von Moral, eine narzisstisch angehauchte Persönlichkeit. Wenn man ganz ehrlich ist: Kein Soziopath würde sich jemals als solch einen bezeichnen, daher denke ich, dass ich auf der sicheren Seite bin. Aber nur weil man keiner ist, heißt es nicht, dass man keiner dieser Züge hat.
Wie eben gesagt, scheine ich über die Jahre von einem altruistischen, empathischen, seelischen Mülleimer, zu einem mehr auf sich fokussierten Typen geworden zu sein, dessen vergangene Persönlichkeit die Leute der Gegenwart ihn immer noch als diesen Mülleimer sehen lassen. Vielleicht sogar mit einer besseren Funktion, da meine immer mehr fehlende Empathie mich besser über Situationen beurteilen lässt, und die Leute wissen, dass sie mir alles erzählen können, es wird nichts über meine Sichtweise von ihnen ändern. Ist schließlich nur eine winzig kleine Information an einem Berg, den man über die Zeit aufgehäuft hat. Ist meine Wandlung über die Jahre etwas Schlechtes? Nein. Denn Gut und Schlecht sind rein subjektiv. Für meinen Lebenslauf hat es mir extrem geholfen, ein Selbstbewusstsein zu schaffen, in dem ich mich nicht hinten dran stelle, sondern hin und wieder auch mal ein bisschen gesunden Egoismus zeige. Es hilft mir dabei, zu evaluieren, ob ich vielleicht zurzeit mehr Hilfe brauche, als der Freund oder die Freundin. Denn wie soll ich auch jemand anderem helfen, wenn ich mir nicht mal selbst helfen kann? Doch mein Punkt von dieser ganzen Offenlegung hier ist: Durch die immer schwächer werdenden Bindungen weiß ich nicht, ob das nächste Mal, das letzte sein wird. Denn vielleicht, werde ich auch keine Schuldgefühle mehr haben.
*
 2x
2x