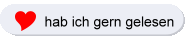Veröffentlicht: 11.10.2021. Rubrik: Persönliches
Geschichten aus dem Neunzehnten | Episode 1: Heimatlos in Sievering
Hier, am Rande des Wienerwaldes, wo Fuchs und Hase sich Gute Nacht sagen, mag die Zeit langsamer vergehen, doch still stehen tut sie nie. Die Reblaus ist immer wachsam in den Weinbergen von Neustift und Sievering! Die Gastgärten der Buschenschanken und Heurigen sperren allmählich zu und entfachen ihr Kaminfeuer, während die Regenwolken sich zusammenbrauen und nordwärts am Talkessel entlangwandern. Die illustren Balkone der Schickeria entsinnen sich ihrer Sterblichkeit und Öffnungszeiten, die Laternen gehen früher an, die rauschenden Gartenfeste finden ein jähes Ende.
Es kehrt Herbststimmung ein.
Fährt der erlauchte Neunzehnt-Bezirkler seinen Sportwagen auf eine Protztour oder führt die mehr als nur wohlsituierte Oberstädtlerin ihren aufwendig frisierten Hund Gassi, wehen ihnen die ersten Herbstblätter freudig entgegen. Rostbraun und gelbgrün tanzt sich das Kaleidoskop dahin, während Reihensechszylinder und Cavalier King Charles Spaniel gleichermaßen selbstbezogen bellen.
Welch ein erhabenes Klangdickicht, hier oben!
Auch der Weg zur Arbeit erscheint einem glatt etwas bunter. Ob Sieveringer-Businessman, Neustifter Privatdoktor, Grinzinger Rechtsanwalt oder Obkirchergassen-Geschäftsführer – irgendwie erfreut man sich doch an der Kulisse. Geldverdienen macht bei schönem Ambiente immerhin mehr Spaß. Ja, allein den Leuten beim Geldmachen zuzuschauen, hat fast etwas Meditatives.
Sogar das ziellose Herumstreifen der Bohemians und ihrer Leiden wirkt plötzlich seltsam legitim. Das ist ihre Jahreszeit. Klar, mit sorgfältig zerfranstem Schaal und modisch schäbigem Hipster-Mantel macht der Nonkonformismus ja auch mehr Freude. Da wird man schnell zum Haudegen! Hier, im warmen Schoß Döblings. Man möge der neuen hochdigitalen Generation ein Beispiel sein.
Und diese Generation ist, wie wir doch alle wissen, stets die wichtigste. Darin steckt die Zukunft. Darin steckt Hoffnung. Ohne den Hauch einer Ahnung, welche Verantwortung sie einst tragen werden, begeben sich Kindheit und Jugend des Neunzehnten auf ihren Schulweg, der nun vom herbstlichen Naturschauspiel betroffen ist. Wie kann man da nur mürrisch dreinblicken, liebe Kinder?
Stumm und mit wissendem Lächeln sehe ich sie meinen frühmorgendlichen Spazierweg kreuzen, während die Sonne steigt und die Regenwolken von letzter Nacht zu einer grauen Erinnerung verblassen.
Da trotten sie! Und ich fühle ihren Widerstand. Für mich liegen Stundenwiederholungen, Schularbeiten und Maturantentum immerhin schon über zwölf Jahre zurück, woran meine neue Vorwahl mich nur zu gern erinnert. Wenn ich an Tagen wie diesen manchmal die Alfred-Wegener-Gasse entlangspaziere und missmutig in die katholische Privatschule blicke, wo ich dereinst selbst Gymnasiast war – langhaarig, mit Akne gezeichnet und viel zu rebellisch für jede Form von Wiederholung – mischt sich mittlerweile doch eine süßlich schmerzende Nostalgie in das Gefüge. Immer öfter wird mir klar, dass sich am Ende des Tages doch eher die guten Erinnerungen durchsetzen. Ein mysteriöser Umstand, der mir beinahe Hoffnung macht.
Vielleicht ergibt am Ende doch alles einen Sinn? Vielleicht endet es irgendwann; das Suchen und Hadern. Das ständige mit sich Ringen und Entzweigerissen-Sein. Der Schmerz. Die Angst. Vielleicht finden die Dinos meiner Generation eines Tages ihren Platz in dieser Welt, deren Bruch wir miterlebt haben. Ein gemütliches Nest, das uns irgendwie an Zuhause erinnern wird.
Vielleicht, ja.
Doch heute schlendere ich ohne große Erwartungen durch den Bezirk, während das herbstliche Treiben mir den Weg ebnet. Natürlich ist es schön, Teil davon zu sein. Natürlich ist es schön, hier zu sein. Das war schon immer so. Auch vor achtzehn Jahren, im noch nicht gänzlich digitalen Jahr Zweitausenddrei, als ich zum ersten Mal die Sieveringerstraße sah. Damals, als alles noch … irgendwie anders war.
Ein Gedanke, dessen übliche Schwere heute nicht ganz an mich heranreicht. Zu schön ist das morgendliche Herbstlicht, zu bunt die Farbenvielfalt.
Immerhin steht nirgends geschrieben, dass man sich nicht als Neunzehnter Bezirkler fühlen darf, nur weil man keinen Sportwagen fährt und die Gegend unsicher macht. Dieser Bezirk ist doch so viel mehr als das! Die Kraft, die hier pulsiert, ist stark, urig und rein. Vom Süden weht der Stadtwind des Juwels des Historismus, kündet von glorreichen Zeiten und Menschen. Vom Osten treibt einem die majestätische Donau imaginäre Gischt in die Augen, während man schon längst die Passage in F-Dur erreicht hat; der spannendste Moment des berühmtesten Walzers der Weltgeschichte. Und vom Nordwesten wehen Winde, die nach Wald und Freiheit duften, Winde, die von Österreich sprechen, welches – wie manch Wiener vielleicht gern vergisst – in westlicher Richtung noch ein gutes Stück weitergeht.
Spaziergänge durch den Neunzehnten, geht mir der Titel meines nächsten Essays, welches ich nie schreiben werde, durch den Kopf. Und während die Sonne Stück für Stück steigt, lasse ich die Scharen der Schulkinder zurück, schlage den Weg durch die schattige Daringergasse ein und komme an der chinesischen Botschaft und am Daringerhof vorbei – eines der schönsten und unterschätztesten Gebäude Sieverings. Der Weg führt bergauf, tiefer rein in die Wiege der ewigen Jugend und weiter weg von irdischem Geschehen und Trubel. Auf den Wogen der Nostalgie schwelge ich nordwärts dahin, während die dörfisch anmutende Schönheit an Überhand gewinnt.
Es ist schon seltsam, hier in Sievering. Irgendwie verliert man doch nie den Bezug zum Wahren und Reinen. Geht man hier oben spazieren, könnte man meinen, die Zeit stünde still. Neben Prachtbauten, Karosserien, hellenischen Marmorstatuen und kunstvoll beschnittenen Hecken, begibt man sich gleichzeitig in ein verblichenes und doch wie eh und je buntes Zauberreich aus fernen Zeiten. In ein Reich, wo Gartenzwerge purzeln und niemals alternde Feenschwärme ihren Staub verbreiten, wo die Gebäude niedrig und einfach sind, und wo gut bestellter Boden und Natur mehr geschätzt werden als irgendwo sonst.
Vielleicht sind es genau diese Gegensätze, die den Neunzehnten so spannend machen, so einladend, so sicher und magisch. Und ganz besonders spannend ist der Moment, den ich jedes Mal, wenn ich diese Route einschlage, insgeheim anstrebe. Die Rückkehr.
Vor der katholischen Kirche St. Severin halte ich inne und setze mich auf eine Bank im Blindengarten, der nun voller Herbstblätter und Kastanien ist. Wie schon oft zuvor, werfe ich einen langen Blick auf diese Kirche, welche die Wirren des Mittelalters überlebte, und nach wie vor hier steht, um uns Verlorenen ein wenig Schatten und den anderen, die zumindest an etwas glauben, Trost zu spenden. Beides legitim, beides völlig in Ordnung. Und doch beiße ich mir jedes Mal auf die Unterlippe, wenn ich die misslungene Statue Jesu in seltsam aggressiver Zurschaustellung des Katholizismus dort hängen sehe, und mindestens genauso sehr, wenn nicht sogar mehr, verletzt mich der Umstand, dass dieses Bauwerk aus dem Mittelalter vor einigen Jahren in einem ganz und gar scheußlichen Beige neu gestrichen wurde. Schnell flüchte ich mich in eine willkommene Erinnerung aus meiner Pubertät, als ich in ebendiesem Garten lag und nach durchzechter Nacht – also nach einem Bier, vermute ich – eine Black Devil anzündete und den Vanillegeschmack hier, im Schoß Gottes, auskostete.
Erst jetzt wird mir die Ironie bewusst.
Und obwohl ich lange nicht mehr rauche, denke ich mir manchmal: Für eine Black Devil würde ich gern wieder husten. Doch diese Marke existiert schon lange nicht mehr, ebenso wenig wie das meiste aus der ominösen Zeit, die mir durch den Kopf geistert.
Schnell erhebe ich mich und kehre all dem den Rücken, um auf der anderen Straßenseite jenen Armbrustbolzen mit dem Herzen abzufangen, der für heute geplant gewesen war. Neben der tunesischen Botschaft steht es, das Haus, in das ich damals einzog. Zwischen den alten Villen ist es nicht einmal besonders auffällig. Fast schon hässlich, aber keinesfalls störend. Weiß und quadratförmig steht es da, ohne Dach, ohne viel Schnickschnack. Im vorderen Garten befindet sich noch das wettergegerbte Gartenhäuschen, daneben parken Autos, die ich nicht kenne. Das Garagentor steht einen Spaltweit offen. Irgendjemand werkelt darin. Die Vorhänge der vielen Fenster sind teils geschlossen und eigentlich bin ich dankbar dafür. Wer möchte schon in seine Vergangenheit blicken und die Einrichtung verändert vorfinden?
Doch ganz oben im Eckzimmer steht der Vorhang halboffen, und obwohl ich nicht hineinsehen kann, bilde ich mir doch ein, dass alles noch genauso wie damals ist. Der Schreibtisch, der Windows XP, der immer abstürzte, die vergilbten philosophischen Werke im hässlichsten Bücherregal der Welt, und der Junge, der dort auf dem Schreibtischsessel seines Vaters saß, und … dasselbe tat wie heute.
Träumen, leiden und schreiben. Zwar nicht immer in dieser Reihenfolge, aber dafür mit Disziplin und Konsequenz.
Ich denke an die vorherigen Häuser, die ich in meiner Kindheit bewohnte. In den Provinzen Belgiens und Südwest-Deutschlands. Bei aller Nostalgie kann ich doch von mir behaupten, diese Kapitel abgeschlossen zu haben. Warum also nicht hier, mit diesem Haus in Sievering? Weshalb träume ich nachts noch von diesem alten Haus? Weil dort Unschuld und Kindheit endeten? Weil dort die Grundfesten meines späteren Lebens gefestigt wurden? Weil dort jene Welt entstand, die nun in fertigen Romanen von jedem bereist wird? Weil dort die Lieder geschrieben wurden, die nun auf Alben und in sämtlichen Streamingdiensten, deren Existenz wir damals nicht ansatzweise hätten erahnen können, die Runde machen?
Oder, weil dort eine Welt endete, in die niemals wieder zurückgekehrt werden kann?
Ich weiß es nicht. Und ich weiß auch nicht, weshalb der Schmerz so tief sitzt, jedes Mal, wenn ich hierher zurückkehre und wie ein Herumtreiber vor den Gartentoren lungere. Ich weiß nicht einmal, ob es normal oder gesund ist, so oft in seine Vergangenheit zu spähen.
Eigentlich weiß ich so vieles nicht.
Mit einem Nicken gen Äther wende ich mich ab und folge der Sieveringerstraße weiter, bis ich ganz oben bin, wo die Buslinie endet. Der Gedanke, rechts abbiegen und jederzeit im Wienerwald untertauchen zu können, spendet Trost und Kraft. Das genügt mir schon, wirklich hineingehen muss ich schlussendlich nicht.
Daher schlage ich meinen Nachhauseweg ein, den Hügel auf der anderen Seite runter, links an den Weinbergen und der fast schon Van Gogh’schen Herbstkulisse vorbei, bis ich im zauberhaften Neustift ankomme. Auch hier könnte ich jederzeit rechts abbiegen und Zuflucht in einem der Heurigen finden. Wieder genügt allein der Gedanke, um mir den Tag zu versüßen.
Ich biege in mein Gässchen, wo es kurz und steil bergauf geht, betrete meine Wohnung, ziehe in bürgerlicher Selbstverständlichkeit die Schuhe aus, mache mir einen Kaffee und setze mich an den Schreibtisch.
Ohne recht viel darüber nachzudenken, tippe ich wenig später auf die blanke, digitale Seite den Titel meiner bevorstehenden Arbeit.
Geschichten aus dem Neunzehnten.
Zwölf Episoden aus Döbling.
Von Jannis Raptis.