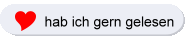Veröffentlicht: 27.03.2021. Rubrik: Nachdenkliches
Lichtquadrate
Lichtquadrate
Vorsichtig kroch ich aus den weichen Kissen meiner Fensternische und schlich barfuß über den Teppich. Der lange Bademantel lastete schwer auf meinen Schultern und schlackerte um meine mageren Arme, während ich langsam durch mein Zimmer lief. Auf die Wand gegenüber des Fensters fielen sechs kleine Lichtquadrate, die ich nun schon einige Minuten in stummer Wut angestarrt hatte. Sie waren nur ein Abbild des Sommers vor der Haustür, des Sommers, der sich auf der anderen Seite einer dicken Backsteinwand abspielte; und die dünnen dunklen Streben zwischen den Lichtquadraten schienen mir förmlich entgegenzuschreien: „Du bist hier gefangen. Du kommst hier nicht raus.“
Noch ehe ich meine Zimmertür erreicht hatte, musste ich kurz innehalten und mich erschöpft gegen die Wand lehnen; eine Träne rann unbemerkt über mein Gesicht, hinterließ eine heiße, salzige Spur auf meiner spröden Haut und tropfte leise auf den Laminatboden. Vor mir lag die Treppe, in letzter Zeit eine der größten Herausforderungen meines Alltags. Ich klammerte mich an das Geländer, doch meine Arme zitterten und auch meine Fingern hatten nicht genug Kraft, um mich im Falle eines Absturzes tatsächlich festhalten zu können – das wusste ich, und ich tapste umso bedächtiger, Stufe für Stufe. Auf Höhe des Flurfensters stützte ich mich erneut an der Wand, hockte mich jedoch nicht hin, denn ich wusste, dass ich dann nicht mehr aufstehen könnte. Draußen lief eine Frau vorbei, mit Babybauch und verschwitztem, rotem Gesicht schob sie einen Kinderwagen vor sich her und rief gleichzeitig einem kleinen Mädchen vor sich zu, es solle nicht mitten auf der Straße laufen. Trotz ihrer offensichtlichen Erschöpfung wirkte sie zufrieden und strahlte, allein durch ihren kraftvollen Gang, Glück und Stolz aus. Ich dachte daran, dass ich meine Tage schon seit Monaten nicht mehr bekommen hatte, und auch daran, dass ich nicht einmal die halbe Treppe annähernd so kraftvoll hinuntergehen konnte, und diesmal waren es keine stillen Tränen; mir entfuhr ein kleines, schmerzerfülltes Seufzen.
Unten angekommen, lief ich unseren schmalen Flur entlang, an der Küche und der Abstellkammer vorbei bis zur angelehnten Wohnzimmertür. Ich spähte hindurch, sah meine Mutter zusammengerollt auf dem Sofa liegen, eingekuschelt in eine Decke. Sie schlief, dennoch war ihr Atem unregelmäßig und ihr Gesicht angespannt. Ihr einst glänzendes, blondes Haar hing ihr nun in stumpfen, angegrauten Strähnen ins Gesicht und ihre Stirn war von Sorgenfalten durchzogen. Mama war in einem Jahr viel älter geworden als andere in zehn Jahren, und mir war wohl bewusst, dass ich der Grund dafür war – aber es reichte nicht. Mein Scham, mein Schuldgefühl, meine Liebe zu meiner Mutter mochten noch so überwältigend sein, sie waren immer noch nicht genug, um mich dazu zu bringen, endlich zu essen. Nichts würde je genug sein, mein Körper wurde immer weniger und mein Inneres schwand mit dahin.
Von einem plötzlichen Gefühl erfüllt, das nicht ganz Entschlossenheit war und doch auch nicht mehr diese abgestumpfte Mutlosigkeit, die sich wie eine dicke Staubschicht über mich gelegt und zu Passivität verdammt hatte, lief ich zurück durch den Flur, tauschte vorn im Eingangsbereich den Bademantel gegen eine leichte, viel zu große Sommerjacke und verschwand leise aus dem Haus. Ich konnte mich nicht daran erinnern, wann ich zuletzt alleine spazieren gewesen war, und es fühlte sich wundervoll an. Zwar ging ich immer noch ziemlich langsam und bedächtig und begann schon nach zehn Metern zu keuchen, doch die frische, warme, nach lauen Sommerabenden würzig duftende Luft milderte die Anstrengung meiner kleinen Schritte erheblich. Ich bog in eine schmale Seitenstraße ab und folgte dieser bis zu einem windschiefen Wegweiser, welcher mich auf den Pfad leitete, den ich früher immer mit meinen Eltern entlangspaziert war – energiegeladen, glücklich, unbeschwert. Jetzt hielt ich alle paar Meter an, hielt das Gesicht in die Sonne wie alle Spaziergänger, die mir entgegenkamen; in der Hoffnung, dabei die gleiche, reine Freude zu empfinden, die sie ausstrahlten… Doch so war es nicht. Meine Haut war zu trocken, zu dünn, ich spürte sie unter der Hitze der Sonnenstrahlen ächzen und reißen. Sie war die Sonne nicht mehr gewohnt, ebenso wenig wie ich es nicht mehr gewohnt war, von Fremden umgeben und auf mich allein gestellt zu sein. Plötzlich wünschte ich mir, es würde regnen, stürmen, gerne auch gewittern. Dann hätte ich mich in einen dicken, langen Mantel hüllen und mit dicken Stiefeln hier entlang stapfen können, und niemand hätte im Vorbeigehen schockiert, angewidert oder besorgt auf meine mageren Beine, meine hervorstechenden Hüftknochen gestarrt. Ich hätte mir die Kapuze tief ins Gesicht ziehen, mich an einen Schirm klammern können, hätte ein Recht darauf gehabt, mich vor dieser Welt zu verstecken – aber nun war es meine eigene Schwäche, meine Unfähigkeit, mit diesen fröhlichen Spaziergängern und dem strahlenden Himmel umzugehen.
In den vergangenen zwölf Monaten, die ich abwechselnd in der Klinik und ans Bett gefesselt zu Hause verbracht hatte, war alles außerhalb dieser Gebäude in Vergessenheit geraten, verdrängt von meinen kranken, gestörten Gedankengängen, die viel zu viel Raum in Anspruch nahmen und dazu geführt hatten, dass ich mich an jedem Ort, der nicht mein Kopf war, wie eine Außerirdische fühlte.
Noch einmal traf mich die Erkenntnis, diesmal mit voller Wucht: Nie wieder würde ich frei und unbeschwert leben können, nicht hier; mit den Gedanken in meinem Kopf war ich nirgends zuhause und ohnehin bald tot, und ohne sie hatte ich keinerlei Kontrolle mehr und auch keinen Rückzugsort, kein Selbst. Erneut spürte ich diesen Anflug von Entschlossenheit, genoss diese Gefühlsregung und begann, beim Weitergehen Steine aufzusammeln. Es war anstrengend, ich taumelte, wurde aufgrund meines Keuchens und Tränen der Anstrengung neugierig angestarrt, doch ich schlich weiter, bog ab, ging unter Weiden hindurch und in den dunkler werdenden Wald hinein, bis ich das Plätschern einen seichten Flusses hörte. Mittlerweile war ich voller Adrenalin, beinahe ausgelassen; das Gefühl, diesen Weg und den täglichen Kampf meiner Gedanken nun endlich überstanden zu haben, machte es mir geradezu leicht, mich in das kühle Wasser zu legen. Die Taschen voller Steine, das Gesicht vor Erleichterung und Glück verzerrt, stieß ich einen seltsamen Laut aus, der Lachen war und Schreien und Seufzen zugleich, und so tauchte ich unter und nie wieder auf.
 4x
4x