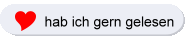Diese Geschichte jetzt als Hörbuch anhören!
Diese Geschichte jetzt als Hörbuch anhören!geschrieben 2017 von Weltenbruch.
Veröffentlicht: 08.11.2020. Rubrik: Grusel und Horror
Besuch bei Oma
Als ich durch das Tor gehe, das nur noch halb in den Angeln hängt und den Garten hinter den hohen Mauern sehe, setzt mein Herz einen Schlag aus. Alles ist verwildert. Meine Großmutter lässt alles verkommen. Nachdem mein Großvater gestorben ist, und wir uns auf der Beerdigung gesehen haben, ist mir klargeworden, dass ich mich bald um sie kümmern werden muss – wer sonst? Ich weiß nicht mal wie sie es geschafft, die Beerdigung zu organisieren, vielleicht hatten sie längst einen Vertrag für so einen Fall gehabt. Der zweite Todesfall innerhalb eines Jahres – erst meine Mutter, dann Opa.
Und jetzt bin ich hier. Drei Wochen Urlaub um alles zu regeln. Mein Chef hat mir zum Glück freigegeben, obwohl es gerade nicht einfach im Büro ist. Zu viele Kunden, zu wenig Leute. Meine Frau sitzt hochschwanger zuhause. Hoffentlich wird das Kind nicht früher kommen. Noch mehr Probleme kann ich gerade nicht gebrauchen. Halt dich an deinen Termin, denke ich und grinse.
An der Tür klingele ich und warte. Nach ein paar Sekunden höre ich Schritte und Oma macht die Tür auf. Im Nachthemd. Es ist sechzehn Uhr.
„Hallo Mortimer – wie war die Fahrt?“
„Gut, Oma.“
Wir umarmen uns. Sie ist dürr, fast nur noch Haut und Knochen.
„Ich dachte, du kommst erst heute Nachmittag, deswegen hab ich mich noch nicht umgezogen.“
Einen Augenblick stutze ich, doch dann lächle ich und nicke.
„War wenig Verkehr deswegen bin ich schon jetzt schon da.“
„In Ordnung, ich zieh mich mal um, setz dich einfach schonmal ins Wohnzimmer – ich mach gleich Kaffee.“
Sie steigt die Treppe nach oben und ich sehe mich um, schaue zumindest, in was für einem Zustand das Erdgeschoss ist. In der Küche stapelt sich Geschirr, Dokumente liegen herum. Es ist nicht wirklich unordentlich, aber kein Vergleich zu früher – früher war alles aufgeräumt, alles sauber. Im Kühlschrank ist fast nur Joghurt. Sonst nur eine angefangene Packung Bratheringe. Angewidert verziehe ich das Gesicht. Morgen muss ich auf jeden Fall einkaufen. Das wird fast zwei Stunden dauern; hier in der Nähe ist nur Wald, keine anderen Häuser. Es ist sehr abgelegen.
Mein Handy klingelt und ich gehe kurz ran. Meine Frau; wir reden nicht lang, nur wie die Fahrt war und wie es ihr geht. Ich bin dankbar für ihr Verständnis, aber ich merke, dass sie Angst hat. „Ich bin bald wieder da.“ Ich lege auf und kurz darauf kommt auch schon Oma runter.
„Kaffee?“
„Gern.“
Wir sitzen am kalten Kamin, über dem noch immer Opas altes Gewehr hängt, und trinken zusammen eine Tasse Kaffee. Hätte man es nicht abgeben müssen? Wir reden nicht viel, aber Großmutter scheint sich trotzdem zu freuen, dass ich da bin. Es ist gut. Irgendwann geht sie nach oben und ich bleibe allein zurück. Es ist unglaublich still hier. Nur draußen vom Wald seltsame Geräusche, aber das war schon immer so. Ich nehme den letzten bitteren kalten Schluck und steige dann die Treppe ebenfalls nach oben, in das Gästezimmer. Als ich das Licht anmache, sehe ich, dass Oma sich fast gar nicht auf mich vorbereitet hat. Die Bettwäsche liegt zwar da, aber es ist nichts bezogen oder sonstiges. Es hat sich viel geändert. Sehr viel.
Ich stelle mich ans Fenster und sehe raus in den dunklen Wald. Als ich klein war, durfte ich immer nur am Rand spielen, damit ich nicht verloren ging. Eines Nachts hatte ich gesehen, wie Oma eines nachts in den Wald gegangen war, daran erinnere ich mich noch. Ich hatte nicht schlafen können und das Fenster einen Spalt aufgemacht. Seltsame Geräusche, immer und immer wieder. Schließlich hab ich Opa geweckt und gesagt, dass Oma im Wald ist; damals ging ich irgendwie davon aus, dass das Verbot, das für mich galt, auch für andere oder so galt.
Ich weiß noch, wie Opa sich aufgesetzt hat und gesagt hat, dass Oma im Wald gegen Monster kämpft. Mein Vater hat mich irgendwann aufgeklärt, dass sie ab und an nachdem Hochsitz sehen musste, weil sich dort immer wieder Jugendliche trafen. Opa war Förster, deswegen wohnten sie auch so nah am Wald, aber sie unterstützte ihn, wo es nur ging. Das Haus gehörte aber nicht zu der Arbeit, sonst hätten sie es nachdem Opa in Rente gegangen war, längst abgeben müssen. Irgendwann würde das mir gehören. Was wäre es wohl wert? 100000 Euro? 150000? Auch heute mache ich das Fenster einen Spalt auf.
Ich beziehe das Bett und lege mich dann hin. Es ist so unfassbar ruhig. In der Stadt hört man immer Autos, immer irgendwen, Besoffene auf der Straße, ab und an Sirenen und hier einfach nichts. Nur die Geräusche des Waldes. Wenige Tiere, aber vor allem das Rauschen des Waldes im Wind.
Am nächsten Morgen sehe ich zuerst nach Oma, aber sie schläft noch, also entscheide ich direkt in die Stadt zu fahren und lasse ihr einen Zettel da. Sie muss endlich wieder etwas Richtiges essen.
Die Fahrt ist langweilig, nur hier und da ein Reh, dass ich umfahren muss. Ich habe das Gefühl, dass diese Straße nur für meine Großeltern gebaut wurde.
Als ich endlich aus dem Wald raus bin, prasseln Geräusche auf mich ein, bald schon erreiche ich die Kleinstadt und den Lärm dieser. Ich halte beim Supermarkt und kaufe alles ein, was wir möglicherweise brauchen könnten, Nudeln, Kartoffeln, Cola, Wasser, Gemüse, Obst, Eingelegtes. Genug um ein paar Wochen zu überleben. Definitiv muss ich sie bald in ein Pflegeheim bringen oder einen Pfleger herholen, auch wenn ich mich nicht wohl bei Letzterem fühlen würde. Die Treppen und alles.
Nachdem alles im Kofferraum verstaut ist, fahre ich zurück. Ich sehe, dass sich ein paar Leute zu mir umdrehen, als ich in Richtung des Waldes fahre. Wahrscheinlich nutzt die Straße sonst wirklich niemand.
Am Haus angekommen, schreibe ich Lana erstmal eine SMS und steige dann erst aus, packe die ersten zwei Tüten und trage sie herein. Oma ist schon wach und steht in Nachthemd in der Küche.
„Hallo, Oma, gut geschlafen?“
„Oh, Mortimer, ich dachte, du kommst erst am Nachmittag.“
Ich sage nichts, sondern räume die Einkäufe in den Kühlschrank.
„Ich koch später für dich.“
„Das ist lieb, ich werd mich noch für ein paar Stunden hinlegen. War die Fahrt denn gut?“
„Die Fahrt war gut.“
„Hast du dein Auto in der Garage geparkt?“
„Nein, an der Straße, aber das klaut schon keiner.“
„Mach das bitte.“
Wir umarmen uns und dann geht sie wieder nach oben. Die restlichen Einkäufe sind schnell verstaut. Erst überlege ich direkt Essen zu machen, aber ich weiß nicht, ob Oma so bald wieder aufsteht.
Spazieren. Ich verlasse das Haus und lehne die Tür nur an; ich habe keinen Schlüssel und ich weiß nicht, wo der Ersatzschlüssel liegt.
Als ich den Waldrand erreiche, überkommt mich ein unwohles Gefühl. Ich habe ihn damals immer nur zusammen mit Opa betreten. Ich greife an meine Tasche in der an meinem Schlüssel das Taschenmesser hängt, was er mir damals geschenkt hat und womit wir aus dickeren Stöcken kleinere Figuren geschnitzt hatten. Ob die noch irgendwo auf dem Dachboden sind?
Ich trete in den Wald ein und lasse das Ganze auf mich wirken. Ich weiß nicht mehr genau, wo der Hochsitz ist und ob er überhaupt noch steht, aber so wichtig ist das nicht. Vorsichtig gehe ich weiter und achte auf jedes Geräusch – ich will nicht von einem Tier angefallen werden.
Plötzlich klingelt mein Smartphone und ich erschrecke mich fast zu Tode.
„Du hast mich fast zu Tode erschreckt“, sage ich, als ich abnehme. „Hier ist alles so verdammt ruhig, aber du, ich hab grad keine Zeit, können wir später reden?“ Sie stimmt zu und ich lege auf.
Ich weiß nicht, warum ich gelogen habe, aber gerade ist das nicht so wichtig.
Erst jetzt wird mir klar, wie viel Zeit ich ständig eingespannt bin. Hier einfach spazieren zu können ist auf eine ganz eigene Art ein Stück Freiheit.
Ich stecke das Smartphone wieder in die Hosentasche, nachdem ich einige Sekunden lang darauf starre und sehe dann wieder auf. Einen Moment lang bin ich irritiert. Am Baum vor mir sind Kratzspuren. Waren die eben auch schon da? Gibt es hier Bären? Mir wird unwohl bei dem Gedanken und ich kehre schnell um.
Wir essen am frühen Nachmittag – es gibt Spaghetti mit Champignons und einer Sahnesoße. Nichts Besonderes, aber Oma schlingt es förmlich herunter. Sie muss lange nicht mehr richtig gegessen haben. Opa hätte sich viel früher um eine geeignete Pflege kümmern müssen.
„Morgen wird es wieder passieren“, sagt sie irgendwann und starrt ängstlich nach draußen.
„Was wird passieren?“
Sie schüttelt den Kopf, wendet den Blick ab und isst weiter.
Ich tue es ihr gleich. Sie baut ab.
Am Abend suche ich mit meinem Smartphone die Kosten für eine Privatpflege heraus. Nicht einmal Wlan gibt es hier. Ich notiere alles und dann hoffe ich, dass Oma genug Geld auf dem Konto hat, denn das würde mein Gehalt komplett auffressen. Vielleicht wäre ein Pflegeheim wirklich eine Option.
Am nächsten Morgen ist Oma schon früh auf und eine Kaffeekanne steht schon auf dem Tisch, als ich aufstehe. Wir setzen uns wieder in die beiden Sessel am Kamin und trinken zusammen eine Tasse. „Oma, ich habe das Gefühl, dass es dir nicht mehr so gut geht.“
„Mein Mann ist tot.“
Ich zögere einen Moment.
„Was würdest du davon halten, wenn wir dich an einen Ort bringen? Ein Seniorenstift oder sowas?“
„Ein Pflegeheim? Das geht nicht, das geht auf keinen Fall.“
Sie steht auf und verlässt das Zimmer. Zwar nicht wütend, aber entschieden. Ich massiere meine Nasenwurzel und frage mich, was ich tun kann, um sie umzustimmen. Irgendwann stehe ich auf und mache Essen. Gefüllte Paprika. Kartoffelbrei und Speck und Bohnen. Vielleicht wird sie das wieder glücklich machen.
Während wir zusammen Essen wirkt sie noch abwesender als sonst, aber ich frage nicht nach. Irgendwann ruft meine Frau an, ich stehe kurz auf, rede kurz mit ihr und lege dann wieder auf. Irgendwie stört es mich. Die letzten Monate waren zu nah, die ganze Zeit. Wenn das Baby da ist, werden wir noch genug Zeit zusammen haben. Nach dem Essen liest sie ein wenig und ich räume etwas auf, ich will das es aussieht wie früher. Zumindest für ein paar Tage. Ich bringe die Papiere weg und immer wieder schaue ich nach draußen. Ich muss den Eingang reparieren, dringend.
Am frühen Abend trinken wir wieder einen Kaffee zusammen und ich versuche nochmal über ein Pflegeheim zu sprechen. „Nein Mortimer. Das geht nicht. Ich geh hier nicht weg.“
„Irgendwann wird ...“
„Nein, das geht nicht.“
Sie sieht mich an und ich merke, dass sie völlig klar ist. Aber ich habe noch ein paar Wochen. Sie blickt zu der Waffe am Kamin und schüttelt dann den Kopf.
„Wir sollten schlafen, es ist spät.“
„In Ordnung, Oma.“
„Ich bring dich ins Bett.“
Es ist ein seltsames Gefühl, als wir die Treppe nach oben steigen und sie mir an der Tür noch Gute Nacht sagt und mir einen Kuss auf die Wange gibt. Sie lächelt und geht dann in ihr Zimmer.
Irgendwie ist die Situation viel seltsamer für mich, als sie sein sollte.
Ich ziehe mich aus, öffne das Fenster, um frische Luft zu bekommen, und lege mich ins Bett, starre an die Decke. Wie soll das werden alles? Oma kriegt einen Pfleger, von dem ich noch nicht weiß, wie wir ihn bezahlen sollen und Lana bekommt ein Kind und ich liege hier und will nie wieder aufstehen, sondern nur noch schlafen.
Und irgendwann schlafe ich tatsächlich ein.
Ich wache von einem Knallen auf und stehe schlagartig auf. Was war das? Es regnet mittlerweile. Ein Blitz? Verschlafen gehe ich ans Fenster und will es schließen – es hat reingeregnet, doch da – meine Großmutter läuft in Richtung des Waldes.
„Oma!“, rufe ich. Sie scheint mich nicht zu hören und verschwindet zwischen den Bäumen.
Scheiße. Ich ziehe mich so schnell wie möglich an und renne nach unten, ziehe meine Schuhe an und gehe raus in die Gewitternacht. Ich kann sie zwischen den Bäumen schon gar nicht mehr ausmachen. „OMA!“, rufe ich noch einmal. Keine Reaktion. Dann laufe ich los und bin in wenigen Sekunden durchnässt. Immer wieder rufe ich nach ihr. Was will sie denn? Noch immer irgendwelche Jugendlichen verscheuchen? „KOMM ZURÜCK!“
Meine Klamotten sind mittlerweile ein einziger nasser Sack und meine Lunge tut weh vom Rennen, aber überall nur Bäume, Bäume, Bäume, nirgendwo sie. Und dann Geräusche. Knurren.
Ich sehe mich um, aber kann nicht erkennen wo es herkommt. Zweige knacken. Meine Nackenhaare stellen sich auf. Wieder ein Knurren, näher und plötzlich werde auf den Boden geworfen und eine Klaue reißt mir die Kleidung auf. Es blitzt, und noch einmal und die Klaue reißt mir die Brust auf. Ich schreie. Ich schreie und schreie. Ich spüre den Atem der Kreatur auf mir, fingere nach meiner Tasche, noch ein Hieb mit der Klaue und dann streifen mich die geifernden Zähne. Speichel tropft in mein Gesicht. Tränen verschwimmen die Sicht, alles tut weh, ich will nicht mehr, ich denke an Oma, denke an mein Kind, an meine Frau, packe das Messer in meiner Tasche, klappe es auf und steche zu immer und immer wieder. Jaulen, hohes Jaulen. Die Kreatur lässt von mir ab, ich rappele mich auf, verfolge das Vieh und steche ihm in den Rücken wieder und wieder und wieder, bis die Kreatur zusammenklappt. Blut strömt aus so vielen Teilen meines Körpers; ich atme schwer und lehne mich an einen Baum, behalte das Wesen im Auge, aber es regt sich nicht mehr. Es sieht ähnlich aus wie ein Wolf, aber nicht … mein Herz ein paar Schläge lang aus, als ich sehe, wie sich die Haare des Tieres langsam in den Körper ziehen.
Da ist die nackte Tierhaut, die verschrumpelt und dann liegt da jemand. Es blitzt. Großmutter liegt da. Es gibt keine Jugendlichen. Gab es nie. Ich sehe hoch in den Himmel. Vollmond. Und dann sehe ich zu der Bisswunde, aus Blut tropft. Der Regen wäscht das Blut von mir. Ich atme tief ein und aus und hole mein Smartphone aus der Tasche.
„Lana, es tut mir leid, dass ich so spät anrufe. Aber … es ist wichtig. Wir müssen umziehen. Komm zum Haus meiner Großmutter, du hast doch die Adresse, oder? Ich erklär dir alles später.“
 5x
5x