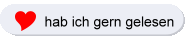Veröffentlicht: 27.10.2022. Rubrik: Persönliches
Woll-Lust
In den 80ern entdeckten viele meiner Schulkameradinnen das Stricken für sich. Ich konnte diese Begeisterung, die immer mehr um sich griff, nicht nachvollziehen, und fand, es gab weitaus spannendere Hobbys für eine 17-Jährige. Handarbeitsgeschäfte schossen wie Pilze aus dem Boden und es war wieder chic, Selbstgestricktes zu tragen. Ein paar Mädels strickten sogar gegen Bezahlung. 50 Mark verdienten sie an einem Pullover. Das machte dann wohl einen Stundenlohn von ca. einer Mark. Die Wolle für ihre Kunstwerke bekamen sie von den „Strick-Boutiquen“ zur Verfügung gestellt, die sich diese Strickware dann zu Werbezwecken ins Schaufenster hängten. Es gab einige Lehrer, die diese Art der „Nebenbeschäftigung“ sogar in ihrem Unterricht duldeten (Musik, Religion und Ethik). Die fleißigen Strickerinnen behaupteten, sie könnten besser zuhören und sich viel besser konzentrieren, wenn ihre Hände mit Stricken beschäftigt waren. Immer mehr Schülerinnen begeisterten sich für dieses Hobby und bald glich unser Religionsunterricht einer Plenarsitzung der Grünen.
Ich verfolgte diesen neuen Trend zwar mit Interesse, war aber noch skeptisch. Zunächst fühlte ich mich noch stark an meine Kindheit erinnert. Meine Mutter war eine leidenschaftliche Strickerin gewesen und hatte uns immer mit allerlei Kleidungsstücken mehr oder weniger „beglückt“. Die Strickpullover meiner Mitschülerinnen waren ganz anders als die Kleidungsstücke meiner Kindheit, richtige Kunstwerke. Ich wurde neugierig, der Funke sprang über – und kurz vorm Abi hing ich an der Stricknadel. Meine Mutter kramte für mich eine Strickfibel aus ihrem Bücherregal, und ich legte los mit den Basics. Bereitwillig wurde mein Taschengeld erhöht, damit ich meine neue Sucht finanzieren konnte. Stundenlang verweilte ich in Handarbeitsgeschäften, diesen Tempeln der Woll-Lust, wo sich die Wollknäuel bis zur Decke stapelten. Gab es etwas Schöneres als lila Baby-Mohair oder Baumwolle in fünf verschiedenen Pinktönen? Ich war im siebten Himmel ...
Nach dem Abi zog ich nach Ludwigshafen, wohnte in einem möblierten Zimmer mit Gemeinschaftsbad und besuchte die Sekretärinnenschule. Alle zwei Wochen fuhr ich mit dem Zug nach Hause, wo mein Freund auf mich wartete. Die einsamen Abende und Wochenenden waren kein Problem für mich. Ich bin gern allein und wusste mich zu beschäftigen. Auch an der Sekretärinnenschule traf ich Gleichgesinnte, die so wie ich an der Stricknadel hingen. Wir strickten um die Wette. Ein Pullover pro Woche war keine Seltenheit. Da wir in der Schule auch viele Stunden an der Schreibmaschine saßen, gab es bald die ersten Sehnenscheidenentzündungen. Ohne mein Strickzeug ging ich nicht mehr aus dem Haus. Ich strickte im BWL-Unterricht, im Zug und in der Straßenbahn und
beim geselligen Zusammensein mit anderen „Stricklieseln“. Sonntagmorgens saß ich auf der Tribüne einer Mannheimer Sporthalle und schaute meinem Freund beim Handballspielen zu. Neben mir war eine ältere Frau, die bei jedem Tor aufsprang und unsere Mannschaft lautstark anfeuerte. Nach der ersten Halbzeit war sie bereits schweißgebadet und ihr Gesicht hatte ein ungesundes Rot angenommen. Ich strickte ganz entspannt vor mich hin und sah nur ab und zu nach dem Punktestand. Als das Spiel vorbei war, war meine Banknachbarin völlig erledigt. Sie atmete schwer, erhob sich von ihrem Platz, schaute mich an und sagte: „Junge Frau, Ihre Nerven möcht ich haben!“ Ich nickte ihr freundlich zu und strickte weiter.
Ich strickte vor dem Essen und nach dem Essen, vor dem Schlafengehen und beim Fernsehen. Ohne mein Strickzeug wusste ich nicht, wohin mit meinen Händen, wurde ganz zappelig. Mein Strickzeug gab mir Halt, spendete mir Trost und ich genoss es, meine eigenen Kleidungsstücke zu kreieren. Oft wurde am Monatsende das Geld knapp. Meine Mutter freute sich zwar über meine Kreativität, aber meine Ausbildung war schon kostspielig genug und es gab keine weiteren Zuschüsse. Ich schränkte mich deshalb beim Essen ein und ernährte mich tagelang von Tütensuppen.
Als Boris Becker im Finale von Wimbledon stand, fuhren wir an den Baggersee. Es war ein heißer Tag und der Strand brechend voll. Gespannt verfolgten die Menschen das Tennismatch im Radio – ich saß auf meinem Handtuch und strickte. An die 100 Pullover wurden es wohl in dieser Zeit. Die fertige Strickware trug ich meist nur kurz – meine Schwester nahm meine Kunstwerke mit Kusshand. Nach meiner Ausbildung fand ich eine Stelle als Sekretärin. Meine Kolleginnen waren in meinem Alter, wir hatten viele gemeinsame Interessen. In der Frühstückspause um halb 10 saßen wir alle an einem Tisch, tranken Kaffee, aßen einen Happen und strickten Pullover für unsere zukünftigen Ehemänner. Seit ich arbeitete, hatte ich weniger Freizeit, aber ich strickte immer weiter. Manchmal stand ich mit Karopapier und Bleistift bewaffnet vor dem Schaufenster des Benetton und kopierte die komplizierten Norwegermuster der ausgestellten Pullover, um sie später nachzustricken. Als Freunde ihr erstes Kind erwarteten, fertigte ich die ersten Babysachen, bald auch für mein eigenes Baby. Ich stricke rosa Schühchen für meine Tochter, die ihr schon nach vier Wochen zu klein waren. Die selbst gemachten Mützen riss sie sich ständig vom Kopf. Von wem hatte sie das nur? Nach und nach verschoben sich meine Prioritäten und ich strickte immer weniger.
Jahre später zogen wir in unser neues Haus ein, ich ging wieder arbeiten und unsere Tochter war schon fast ein Schulkind.
Ich sitze im Wohnzimmer und stricke an einem zartgelben Pullover mit vielen komplizierten Mustern. Ich bin sooo müde ... Einer plötzlichen Eingebung folgend, stopfe ich mein Strickzeug zurück in die Plastiktüte, laufe zur Tür hinaus und werfe den Beutel in die Mülltonne. Seitdem bin ich clean, aber die Strickfibel steht noch immer in meinem Bücherregel – man weiß ja nie ...
 3x
3x