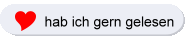Veröffentlicht: 11.07.2023. Rubrik: Grusel und Horror
Das Verblassen
Wie fühlt sich wahre Einsamkeit an? Kommt ihr ein Mensch am nächsten, der alle, die er liebt verloren hat? Oder ein Mensch, der niemanden liebt und von niemandem geliebt wird, obwohl er noch viele um sich hat? Ich habe die Antwort auf diese Frage erfahren, denn ich habe das große Verblassen erlebt.
Ich schreibe dies mit meiner letzten Kraft, damit wenigstens etwas von mir übrigbleibt, wenn alles andere verschwunden ist. Denn auch wenn sich niemand dann an mich erinnern wird, so mag vielleicht dieser Bericht einem interessierten Anlass zur Nachforschung geben, bis er irgendwann beweise findet, dass ich tatsächlich gelebt habe. Ich weiß nicht, wann es begonnen hat, wann ich mir diese schleichende Krankheit einfing. Vielleicht trage ich den Keim schon seit meiner Kindheit in mir, vielleicht habe ich sie in meiner unerfüllten Jugendzeit erworben, oder in meinem verfehlten Erwachsenenleben. Ich bemerkte es vor einigen Jahren. Immer wieder stellte ich fest, dass immer mehr Menschen immer mehr Dinge über mich vergaßen. Meine Freunde – wenn ich sie denn so nennen kann, denn sie waren wohl eher Zwangsgenossen, die nicht wirklich von sich aus Energie aufgewendet hätten mit mir Zeit zu verbringen – wussten die grundlegendsten Dinge über mich nicht. Hätte ich nicht so viel Mühe aufgewandt in meinem grenzenlosen Narzissmus, so hätte niemand daran gedacht, dass ich beispielsweise an bestimmten Filmen Interesse haben könnte, zu denen man sich gemeinsam im Kino verabredet hätte. Niemand hatte etwas dagegen mich dabei zu haben, aber niemand hätte von sich aus an mich gedacht. Und ich gab mir stets Mühe auf mich aufmerksam zu machen. Doch je mehr ich von mir aus darauf achtete, dass andere mich wahrnahmen, desto weniger schien das von selbst zu geschehen. Überhaupt schienen sich die Leute an immer weniger Eigenschaften von mir erinnern zu können, obwohl sie von diesen mitbekommen haben mussten. Doch diese Krankheit war langsam und schleichend… und sie entwickelte sich weiter. In Gesprächen schienen mich die anderen immer weniger wahrzunehmen. Sobald ich mich einschaltete, bemerkten sie überrascht, dass ich auch noch da war. Das war der Punkt, an dem ich spürte, das etwas gewaltig nicht richtig war. Ich redete viel mit meinem Arzt über meine Probleme und erzählte auch, dass ich das Gefühl hatte, immer weniger beachtet zu werden. Mein Therapeut, der mittlerweile an mir viel Geld verdient haben musste, riet mir mich gegenüber anderen zu öffnen. Doch ich wusste nicht wie. Stets beschlich mich die Angst, die anderen könnten sich angegriffen fühlen und mein Problem als Vorwurf an sie verstehen. Darum sprach ich mit niemandem. Doch es wurde immer unerträglicher. Niemand dachte an mich. Meine Freunde verabredeten sich in meiner Gegenwart zu gemeinsamen Unternehmungen und da ich mittlerweile den Mut verloren hatte auf mich aufmerksam zu machen, kam niemand auf mich zu. Niemand schien zu merken, dass es mir schlecht ging, da ich nicht von mir aus auf meine Probleme aufmerksam machte. Eine Zeitlang dachte ich, dies sei die egoistische, narzisstische Natur aller Menschen, der ja auch ich unterlegen war. Doch dies schien nicht zu stimmen, denn ich erlebte meine Freunde stets als sehr aufmerksam und sorgsam einander gegenüber. Nur an mich schien niemand mehr zu denken, denn ich sorgte nicht dafür. Niemand sah mich mehr an in Gesprächen, es sei denn ich suchte lange und intensiv Augenkontakt. Wann immer ich etwas sagte, sahen mich überraschte Blicke an, die ausdrückten, dass sie meine Anwesenheit bisher nicht zur Kenntnis genommen hatten. Selbst Gespräche, die mit mir geführt wurden, wandelten sich und plötzlich war ich nicht mehr Teil der Unterhaltung. Manchmal wurde ich etwas gefragt, oder dachte das zumindest, bis dann jemand anderes auf diese Frage antwortete und ich einfach unsichtbar zu sein schien.
Lediglich eine Freundin schien mich noch wahrzunehmen. Sie sah mich regelmäßig an, als würde sie mich noch sehen und an mich denken. Ihr Blick war sogar aufrichtig freundlich und liebevoll. Manchmal fragte sie mich, wie es mir ginge, oder lud mich zu gemeinsamen Filmabenden ein. So beschloss ich schließlich mich ihr zu öffnen. Ich erzählte ihr von meinen Gefühlen und Ängsten und sie schien mir besorgt und aufmerksam zuzuhören. Da öffnete sich die Tür und einer ihrer Mitbewohner trat ein. Er schien mich nicht wahrzunehmen und fragte sie, ob sie für eine Weile Zeit hätte, um etwas zu spielen. Sie bejahte das und verließ ohne ein weiteres Wort an mich den Raum. Die Tür schloss sich und ich war allein. Ich konnte es nicht fassen. Ich wollte weinen, doch keine Tränen kamen mir. Ich zog mich still und leise auf mein Zimmer zurück und verbrachte den gesamten Tag in meinem Bett, genauso wie den nächsten. Ich aß nichts, trank nur wenig, schlief viel zu viel. Und niemand schrieb mir, oder fragte mich, wo ich blieb. Weder auf der Arbeit noch in meinem Freundeskreis schien jemandem meine Vakanz aufzufallen, so als wäre ich nie dagewesen. Ich begann mich zu fragen, ob ich überhaupt existierte. Oder ob ich mich mir nur einbildete. Aber das konnte doch nicht sein, schließlich hatte ich noch nicht die genialen Ausführungen Descartes vergessen, der mich gelehrt hatte, dass ich, solange ich denken konnte, stets von meiner eigenen Existenz überzeugt sein könne, nein überzeugt sein müsse. Denn wenn ich nicht war, wie hätte ich mich dann mir einbilden können? So musste der Schluss doch lauten, dass ich das einzig echte und alles um mich herum unecht war. Doch auch das befriedigte mich nicht, denn in meiner Erfahrung waren mir Menschen und Welt stets als echt vorgekommen. Und meine Erfahrung war doch schließlich das Einzige, auf dem mein Weltbild im Kern basierte.
So verzweifelte ich eine Woche lang immer mehr, bis ich schließlich wieder eine Therapiesitzung hatte. Ich klingelte an der Tür. Nichts geschah. Nach dem dritten Klingeln öffnete mein Therapeut die Tür. Er schaute mich eine Weile fragend an. Dann sagte er: „Wie kann ich ihnen helfen?“. Ich sah ihn verzweifelt an. Mit brüchiger Stimme sagte ich: „Ich… Ich habe doch einen Termin bei ihnen.“ Er überlegte eine Weile. Dann antwortete er ruhig und freundlich: „Ihr Name war?“. Ich konnte es nicht fassen. Er musste mich doch erkennen, nach all den Sitzungen, die ich bei ihm hatte. Ich stammelte meinen Namen. „Nun ich glaube nicht, dass sie schon einen Termin bei mir haben.“, sagte er ruhig und bestimmt, „Aber, wenn sie das wünschen, dann können sie gerne zu einer Sprechstunde vorbeikommen. Sie haben Glück, ich habe im Moment noch freie Plätze.“ Ich schaute ihn vollkommen ungläubig an, darauf wartend, dass er einen absolut unangemessenen Scherz offenbaren würde. Doch er schaute mich nur ruhig wartend an. Plötzlich antwortete ich ihm mit klarer ruhiger Stimme und beteuerte, dass ich mich nur in der Adresse geirrt hatte. Er schloss die Tür hinter sich und ließ mich alleine zurück. Ich wusste weder vor noch zurück. Und ich ärgerte mich über meine abwehrende Haltung, vielleicht hätte er mir doch helfen können. Da entschloss ich mich noch ein weiteres Mal zu klingeln. Kurz darauf öffnete sich die Tür. Mein Therapeut schaute mich an. Ich wollte gerade etwas sagen, da schaute er zur Seite, an mir vorbei und dann zur anderen. Dann schloss er schulterzuckend die Tür. Ich wollte es einfach nicht wahrhaben, darum klingelte ich erneut und wieder öffnete er die Tür. Diesmal sichtlich genervt. Sofort rief er, „Hallo? Wer klingelt hier?“. Ich wollte schreien ich stand doch direkt vor ihm. Doch ich brachte keinen Ton heraus, wie in einem jener kindlichen Albträume, bei denen man seine Eltern um Hilfe rufen möchte, weil ein Monster unter dem Bett hervorgekrochen ist, doch keine Stimme mehr hat. Ich wedelte mit den Armen… und erschrak. Meine Arme waren unfassbar dünn geworden in den letzten Tagen und Wochen, doch das war es nicht, was mich verstörte. Durch meine Arme hindurch schien das Licht der Sonne, ich konnte durch meine Arme hindurch blicken, ich begann durchsichtig zu werden. Mein Therapeut schloss die Tür. Voll morbidem Entsetzen kehrte ich um. Ich schleppte mich so gut mich meine schwächlichen Beine trugen in Richtung meiner Ein-Zimmer-Wohnung. Mir war übel. Als ich durch die Innenstadt humpelte nahm mich niemand mehr wahr. Ich schien vollkommen durchlässig zu sein. Manchen gingen einfach durch mich hindurch. Mein Magen drehte sich um und ich erbrach mich auf offener Straße. Niemand sah es. Schließlich erreichte ich den großen Wohnblock, in dem ich lebte, wenn man denn noch von leben sprechen möchte. Ein einziges Ziel noch trieb mich an, eine Erinnerung an mich zu hinterlassen. Etwas greifbares, dass Leuten einen Hinweis geben mochte, dass es mich gegeben hatte. Es war meine schreckliche, zu unfassbarer Größe übersteigerte Selbstverliebtheit, die mich nun nur noch am Leben hielt. Mein manisches, zur Sucht gewordenes Bedürfnis, einen Eindruck zu hinterlassen. Meine panische, zu Wahnsinn verkommene Angst, vergessen zu werden. Ich schleppte mich die Treppen hinauf und kroch in mein Zimmer. Ich griff nach Stift und Papier und begann aufzuschreiben, mit der letzten Kraft, die ich noch hatte.
Nun sitze ich hier und warte auf das Ende. Ich verblasse immer mehr. Ich werde nie erfahren, woher diese Krankheit kam und warum ich zu diesem Ende bestimmt war. Wer immer dies findet, soll die Spuren meines Daseins suchen. Ergründet was in meiner Kindheit geschehen ist, was ich in meiner Jugend getan habe, was ich in meinem Erwachsensein versäumt habe. Und achtet darauf alles anders zu tun, als ich, damit nicht auch ihr von dieser Krankheit befallen werdet, damit nicht auch ihr das große Verblassen erlebt.
Versucht rauszufinden, was hiervon wirklich geschehen ist, denn ich kann mich nun nicht mehr erinnern. Eine letzte Tat bleibt mir noch. Die Sonne scheint hell durch das weit offene Fenster.
 1x
1x