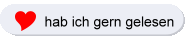Veröffentlicht: 01.10.2022. Rubrik: Nachdenkliches
Die Heiterkeit der sterbenden Eisschollen
Es war im letzten Winter.
Ich ging den alten Treidelweg entlang, links der Hund, rechts der Fluss, hinter mir die Stadt. Auf dem schwarz glänzenden Wasser trieben Eisschollen, allerdings nicht von der Art, wie man sich Eisschollen vorstellt, als Teile eines zerborstenen Panzers, der den Fluss überzieht wie Reptilienhaut oder als spitzgratig aufgeworfene Geschiebe, vor deren gefühllos starrender Kälte einem graust. Diese waren gerade dabei sich aufzulösen; über Nacht hatte starkes Tauwetter eingesetzt und der weißen Pracht das Ende verordnet. Vielleicht ist „Scholle“ auch nicht das rechte Wort, denn diesen Gebilden fehlte die gläserne Bestimmtheit, die Eisschollen auszeichnet, sowie, im Gedränge, die Gefahr für die Schifffahrt. Es waren rundliche, zum Rand hin zerfließende, silbrig glitzernde Gebilde; sie trieben dahin, harmlos-dünne Eisflinsen, einzeln oder in Gruppen. Manche drehten sich langsam, wie tänzelnd, im Kreis, von irgendeinem unsichtbaren Wasserstrudel bewegt; andere trieben gemächlich aufeinander zu, verschmolzen kurz und trennten sich wieder. Eine Weile sah ich ihrem Spiel im Gehen zu, dann blieb ich fasziniert stehen.
Mein Gott, Eisschollen – Eisflinsen – einerlei und nicht der Rede wert.
Doch!
Etwas war da, das über das alltäglich Triviale hinauswies, zumindest empfand ich es so. Da war diese absolute Ruhe, mit der sie dahintrieben, eine unheimliche, unfassbare, geradezu absurde Ruhe, kein Laut war zu hören, obwohl doch eine Unzahl dieser Gebilde eilig an mir vorbei zog. Ich dachte an den brausenden Straßenverkehr in der Stadt hinter mir, der trotz aller Hektik doch nur schrittweise vorankommt. Hier war ein stetiger, gleichmäßiger, beständiger Fluss, nicht geruhsam träge, aber auch nicht hastig übereilt, etwa in der Geschwindigkeit eines zügigen Fußgängers. Dabei schien das schwarz wellende Wasser zu stehen; für einen Moment war mir unerklärlich, wieso die Eisschollen sich überhaupt bewegten. Was ist das für eine Kraft, grübelte ich, die sie unaufhaltsam in scheinbar stehendem Wasser, geradezu selbstbewusst auf ihr Ziel zutreibt, dem sicheren Untergang entgegen?
Die Schwerkraft.
Natürlich, die auch. Aber die Schwerkraft macht nicht heiter.
Inzwischen waren die Eisgebilde – oder was noch von ihnen übrig war – deutlich kleiner geworden.
Wieder trieben zwei aufeinander zu und berührten sich an den Rändern, andere umkreisten sich oder drehten sich langsam um ihren Mittelpunkt – und da erkannte ich, woher diese Gebilde ihre Kraft nahmen.
Auch wenn man mich für einen Narren hält: Jetzt noch, wo alles Eis weg und der Winter dahin ist, bin ich fest davon überzeugt, dass diese Drehungen keine Zufallsbewegungen waren, sondern verträumte Tänze, Todestänze, und dass sie sich berührten, nicht, weil es die Strömung wollte, sondern um sich ein letztes Mal zu spüren und Lebewohl zu sagen. Es war diese unbekümmerte, geradezu heitere Gelassenheit, mit der sie in endlosem Strom ihrem Schicksal, die völlige Auflösung, klaglos entgegen schwammen.
Dieser bescheidene Fluss war ein Spiegel der ungeheuren Tiefe der Zeit, mit ihrem endlosen Kommen und Gehen von Gestalten und Schicksalen, ein Symbol des Weiterlebens, des Weitergehens, trotz allem.
Der Hund zerrte an der Leine. Ich sah ihn an und blickte in seine Augen, die fast nur aus Pupillen bestehen. Und diese Pupillen waren ebenso schwarz wie das Wasser im Fluss, ihr Blick ebenso tief und ruhig, ebenso alt und unergründlich in ihrem naturhaften Wissen, ebenso zeitlos gelassen wie die sich auflösenden Eisschollen.
In hohem Satz sprang der Hund in einen zerfließenden Schneehaufen und erschnupperte freudig eine nur ihm verständliche Botschaft.
Auf einmal erfüllte mich eine große Zuversicht. Ha!, rief ich in den neblig trüben Tag hinein, auch in hunderttausend Jahren wird es Hunde geben, die Schnee und ihr Herrchen lieben, und in einer Million Jahre noch Flüsse, auf denen sterbende Eisschollen ihren Todestanz tanzen!
Beglückt ging ich weiter.
 7x
7x