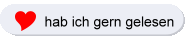geschrieben 2020 von ClariceCaine.
Veröffentlicht: 22.07.2020. Rubrik: Nachdenkliches
Deliler
„Wenn ich in der Schlacht falle, schreibt auf meinen Grabstein: Nimm an, was das Schicksal für dich vorsieht.“
Dies war das Zitat, welches sich in ihre Gedanken eingebrannt hatte. Es war aus einem Film, den sie erst kürzlich gesehen hatte: Die Deliler. Er war auf Geschichten über Krieger aufgebaut worden, welche wirklich existiert hatten. Die Filmgeschichte selbst war reine Fiktion und orientierte sich nur grob an der Realität, hatte sich aber den Namen der Elitekrieger ausgeborgt. Ursprünglich stammte der Name von dem Wort DELI ab, Deliler war einfach nur der Plural des Wortes.
Im osmanischen Reich waren die Deliler Reiter der Provinztruppen. Der Legende zufolge sollen sie im Kampf tollkühn, ohne jede Spur von Angst auf den Gegner losgegangen sein und niemals aufgegeben haben.
[ DELI (Delü):Soldat; osmanisch: Tapferer, heldenmütiger, verwegener, tollkühner, wahnsinniger, verrückter – Wikipedia]
Im Artikel, den sie gelesen hatte stand auch, dass sich diese Krieger häufig mit Opium berauschten. Mohn schien also bereits im 14. Jahrhundert als Droge bekannt gewesen zu sein.
Ob die Deliler das Opium benutzten um im Kampf weniger Schmerzen zu spüren oder versetze es sie in eine Art kampfrausch? Leider ließ sich in keinem Artikel eine Antwort darauf finden, doch je mehr sie las desto faszinierter war sie.
Diese Männer aus dem 14. Jahrhundert verachteten Schmerz und Schwäche, gaben niemals auf, gingen immer an ihre Grenzen und taten was immer nötig war um ihren Auftrag zu erfüllen. Wer als Deli kein erfolgreicher Frontkämpfer war, wurde weder befördert noch anerkannt oder belohnt. Einzig und allein die Leistung zählte, nichts anderes. Weder aussehen noch Charakter oder familiäre Herkunft. Man musste nur ein mutiger und tapferer Kämpfer mit Durchhaltevermögen sein, das allein war ausreichend.
Waren sie herausragend, wurden sie sogar als Leibwache eingesetzt und zu Würdenträger ernannt. Alle bekannten Zeichnungen zeigten die Deliler aber im Kampf – ausnahmslos.
Seufzend lehnte sie sich zurück und gönnte sich eine Lesepause. Träumend sah sie aus dem Wohnzimmerfenster in die Dämmerung hinaus und wünschte sich ins 14. Jahrhundert, zu den Kriegern der Deliler, fort aus heutigen, komplizierten Zeit.
Sie hasste die Neuzeit. Jeder den sie kannte war entweder gehetzt, unzufrieden mit seinem Job, dem Besitz oder mit sich selbst. Fehler gingen vor Leistung, Aussehen vor Persönlichkeit.
Ihr war sehr wohl bewusst, dass sie in ihren Gedanken so manches Mal die Last der Welt auf ihren Schultern trug und nichts an den Gegebenheiten ihrer Zeit ändern konnte, dennoch verhagelte es ihr jedes Mal gewaltig die Laune wenn sie darüber nachdachte. Sie war nun mal so und mittlerweile hatte sie sich akzeptiert. Der Weg dorthin war lang und schmerzhaft gewesen aber sie war ihn gegangen und sie hatte es geschafft.
Früher hatte sie bei jeder emotionalen Belastung angefangen zu heulen wie ein Schlosshund und vor allem Angst gehabt, weil sie unsicher war und sich unwohl in ihrem eigenen Körper fühlte. Am Ende war es soweit gewesen, dass sie das Haus nur noch verlassen hatte wenn dies zwingend nötig war. Ihre Emotionalität hatte sich in Depressionen und Selbsthass verwandelt und fraß sie innerlich langsam auf.
Doch dann geschah etwas in ihrem Inneren, nachdem noch ein paar weitere Dinge fürchterlich schief gelaufen waren.
Zuerst zerstritt sie sich durch ihre Verfassung mit ihrer Mutter und zu allem Übel verließ ihr Verlobter sie nach drei Jahren Beziehung. Er sagte er käme weder mit ihrer Persönlichkeit noch mit ihren Stimmungsschwankungen zurecht.
Nachdem sie also wieder vollkommen alleine war fing sie an zu verstehen, dass es jetzt nur noch zwei Optionen für sie gab: Entweder ließ sie alles so laufen wie bisher und ihr ganzes Leben ging vor die Hunde oder sie änderte etwas. Irgendetwas.
Und das tat sie, zuerst an ihrer Einstellung und Motivation dann an ihrem Verhalten.
Bei Unsicherheit gegenüber anderen Menschen fing sie zuerst einfach damit an freundlich zu lächeln und das beklemmende Gefühl in ihrer Brust und dem Magen zu ignorieren. Heute würde sie niemanden der sie um Rat bitten würde zu Ignoranz sich selbst gegenüber raten. Rückblickend betrachtet kam es ihr selbst bescheuert vor, doch damals wusste sie nicht wo sie anfangen sollte und griff somit nach jedem Strohhalm und Ignoranz hatte funktioniert.
Nachdem sie merkte das ihre Methode Wirkung zu zeigen schien und ihr die Kommunikation mit Fremden leichter zu fallen begann, fügte sie ihrer täglichen Routine noch etwas neues hinzu.
Sie hatte davon in einem Fachartikel gelesen, es war so etwas wie psychologische Eigenkonditionierung. Immer wenn das altbekannte Beklemmungsgefühl zurückkehren wollte sagte sie innerlich folgenden Satz zu sich und wiederholte ihn im Geiste immer und immer wieder: „Egal was du gerade fühlst, geh deinen Weg weiter, lass dich nicht abbringen. Niemand weiß es, niemand kann deine Unsicherheit sehen. Es ist nur in deinem Kopf.“
Es dauerte Monate, kostete viele Tränen und das ständige Bedürfnis aufzugeben war ihr Begleiter, doch irgendwann bemerkte sie eine schleichende Veränderung an sich selbst. Alltägliche Dinge, die früher nicht mehr möglich gewesen waren, erledigte sie plötzlich ganz nebenbei.
Ein Telefonat mit einem Fremden oder das Annehmen eines Pakets an der Haustür – Dinge die andere Menschen als völlig normal erachteten – tat sie jetzt endlich auch ohne sich den Kopf über ihr inneres Angstgefühl zu zerbrechen.
Der nächste Schritt war noch viel unspektakulärer als die Ersten.
Sie begann überall in der Wohnung kleine, farbige Post-it Zettelchen zu verteilen. Mal klebten sie am Spiegelschrank im Badezimmer oder auf dem Lenkrad ihres Autos, ein anderes Mal lag er einfach nur auf dem Küchentisch, an dem sie jeden Morgen mit ihrem Kaffee saß. Darauf standen nichts weiter als kleine Nettigkeiten und Motivationen für ihren Tag und vor allem für ihre Laune. Einfache aber effektive kleine Sprüche wie „Du kannst alles schaffen – Schritt für Schritt!“ oder „Du bist besser als du glaubst, also gib nicht auf.“ Nichts daran war besonders, doch es half ihr über den Tag.
Natürlich gab es trotzdem weiterhin schlechte und auch sehr schlechte Tage, denn auch sie war nur ein Mensch. Dann fing sie wieder bei jeder Kleinigkeit an zu heulen und wollte am liebsten in ihren Kokon zurückkriechen. Doch sie tat es nicht, nicht dieses Mal. Aufgeben war keine Option mehr, vollkommen egal wie gut die Gründe dafür auch schienen.
Sogar mit ihrer Mutter verstand sie sich inzwischen, für die sonst herrschenden Verhältnisse, wieder sehr gut. Die meisten Menschen hätten sich den heutigen Umgang zwischen ihr und ihrer Familie angeschaut, den Kopf geschüttelt und ihr ein offenes Ohr zum Reden angeboten. Das war es jedenfalls was ihre Freunde taten. Schmunzelnd lehnte sie jedes Mal dankend ab, auch wenn niemand sie verstehen konnte.
Wie sollten ihre Freunde auch, kannten sie doch die frühere Situation nicht und wussten nichts von der vielen Arbeit die nötig gewesen war um an den heutigen Punkt zu gelangen. Dennoch war sie sehr dankbar solche Freunde zu haben, denn viele waren ihr nach der jahrelangen Isolation nicht geblieben. Eigentlich gab es nur noch zwei Arten von „Freunden“ in ihrem Leben, die sie energisch voneinander getrennt hielt.
Da waren die Leute von denen sie wusste, dass sie – situationsunabhängig - immer da sein würden und zwar wirklich immer.
Wenn sie sich zum Beispiel vorstellte, eines Morgens mit ihrer Unterwäsche auf dem Kopf, planlos aber nicht sorglos, irgendwo in Oslo aufzuwachen und dann eine dieser Personen anrufen würde – sie würde kommen und sie kommentarlos abholen.
Die zweite Gruppe bezeichnete sie eher als entfernte Bekannte. Das waren Leute mit denen man sich zwar auf persönlicher Ebene verstand, aber dort endete die „innige Freundschaft“ – wie manche es nannten – auch schon wieder. Man grüßte sich wenn man sich auf der Straße traf oder lief sich zufällig auf Geburtstagen über den Weg.
Diese Freund konnten immer dann besonders freundlich sein, wenn sie etwas von ihr wollten: „Hast du vielleicht Zeit mir beim Umzug zu helfen? Uns fehlt noch ein Auto.“ Oder „ Kannst du mir bitte einen Zehner leihen? Kriegst du ganz bestimmt nächste Woche wieder.“
Im Wesentlichen hatte sie ihre echten Freunde auf weniger als fünf Menschen beschränkt, aber daran störte sie sich nicht. Lieber echte Freunde statt viele, oder?
Früher hätte sie sich nicht nur lange über die anderen aufgeregt, sondern wäre - wie so oft - auf sehr langen Gedankenumwegen zu dem Schluss gekommen, dass alles an ihr und ihrer merkwürdigen Persönlichkeit liegen musste. Inzwischen beschränkte sich ihre emotionale Reaktion bei solchen Problemen auf ein Augenrollen oder Schulterzucken und damit ließ sie die Leute ihren eigenen Weg gehen. Die Richtigen würden bleiben und Neue dazu kommen.
Diese Gedanken brachten sie auch jedes Mal zurück zu ihrer Jugend, das konnte sie leider nicht verhindern. Sie dachte nicht gerne daran zurück, denn bis auf wenige schöne Erinnerungen hatte sie in ihrer Jugend eigentlich nur gelitten – entweder unter anderen oder sich selbst. Es wurde zu einem Teufelskreis. Bis heute glaubte sie, dass ihre späteren Probleme und ihr Isolationsverhalten den Ursprung zum Großteil in dieser Zeit hatten.
Bis zur achten Klassenstufe war alles normal, als sie plötzlich eine Veränderung wahrnahm. Zuerst dachte sie es würde daran liegen, dass sie nicht anfing Kleider und Absätze oder Make-Up zu tragen, wie die anderen Mädchen, aber schnell wurde ihr klar, dass sie einfach anders war. Sie wurde zwar in der Clique geduldet, die musternden Blicke bemerkte sie aber trotzdem. Sie hätte sich ändern können, sich anpassen, aber das kam ihr nie in den Sinn. Kein einziges Mal und das obwohl sie das Verhalten der anderen furchtbar verunsicherte.
Ein Ereignis aus dieser Zeit würde sie niemals vergessen. Mittlerweile wusste sie zwar nicht mehr genau um was es damals eigentlich gegangen war, doch es tat ihr bis heute jedes Mal in der Seele weh wenn sie daran zurück dachte.
Es war ein Junge aus der Unterstufe gewesen, sie war etwa zwei Klassen über ihm und kannte ihn daher nicht persönlich. Am Ende des Ganzen stand er in der großen Pausenhalle, vor allen möglichen Schülern der Schule, nass; von oben bis unten mit Farbe übergossen und weinte bitterlich. Egal wie sehr sie es wollte, sie konnte sich nicht an viel mehr erinnern, auch nicht an das was seine lachenden Klassenkameraden ihm zuriefen, aber die Farbe an ihren Händen zeugte davon dass diese Jungen dafür verantwortlich gewesen waren.
Was ihr wirklich an die Substanz ging, war die Tatsache, dass es zwei Arten von Mitschülern gab: Die, die mitlachten und ihn noch zusätzlich verspotteten und die, die so taten als hätten sie nichts mitbekommen oder betreten weg sahen. Damals hatte sie das Bedürfnis gehabt zu dem Jungen zu laufen und ihn so schnell es ging aus der Halle zu ziehen, aber sie hatte einfach nicht den Mut dazu gefunden. Stattdessen hatte sie die Halle mit Tränen in den Augen verlassen und verbrachte von da an alle Pausen alleine.
Noch schlimmer machten es am Nachmittag ihre Eltern, als sie ihnen von dem Vorfall erzählte. Diese nahmen nicht mal wahr wie mitgenommen ihre Tochter war, hatten keine tröstenden Worte oder halfen ihr dabei sich zu beruhigen. Sie erntete nur ein paar Blicke, die man bestenfalls als mitleidig bezeichnen konnte und die Frage, ob denn wenigsten jemand etwas unternommen hätte. Als sie verneinte und sich bereits wieder schämte, dass sie nicht getan hatte, waren ihre Eltern schon wieder im Nebenzimmer verschwunden. Das letzte was sie hörte war ein dahingesagtes „Denk einfach nicht mehr daran.“
Inzwischen hatte sie sich eine Tasse Tee gemacht und versuchte die Gedanken an all diese Dinge wieder los zu werden. Also sah sie sich in ihrer Wohnung um und überlegte was sie tun sollte. Ihren Haushalt hatte sie bereits erledigt und es dauerte noch mindestens zwei Stunden bis ihre Tochter aus der Schule kam, doch sie wusste das es ihr nicht gut tun würde weiter in ihren Erinnerungen zu ertrinken.
Zum einen, weil einfach nicht viel Positives dabei war und zum anderen, weil es sie – eben deswegen – in eine emotionale Abwärtsspirale ziehen würde. Das war etwas das sie auch in mühsamer Kleinarbeit hatte lernen müssen: Auf sich und ihre Emotionen zu achten und zu lernen was ihr gut tat und was nicht.
Ihr fiel nichts Besseres ein, also beschloss sie schon einmal alles für das Mittagessen vorzubereiten und dabei ihrer Lieblingsmusik zu lauschen. Musik half ihr sich unter Kontrolle zu halten und nicht wieder einzubrechen und keine Minuten später beschallte Jeremy Renner mit „December Days“ ihre Küche. Wenigstens tat sie so etwas Sinnvolles und würde nicht mehr nachdenken. Sie wollte gut gelaunt und aufmerksam sein, wenn ihre Tochter von der Schule nach Hause kam und von ihrem Tag erzählen wollte – ihre Vergangenheit hatte hier keinen Platz mehr.
Mitsummend suchte sie alle Zutat zusammen, begann damit diese zurecht zu schneiden und in eine kleine Schüssel zu füllen. Heute gab es einen Gemüseauflauf mit Knoblauch und Nudeln, überbacken mit Käse.
Während sie arbeitet und der Musik lauschte fiel ihr Blick auf den kleinen Kalender auf der Fensterbank. Ihre Augen blieben an einem kleinen, roten Kreuz hängen und ließen sie innehalten. Sie begann zu lächeln und ein Glücksgefühl breitete sich in ihrer Brust aus. In drei Wochen war es soweit, dann war der Tag mit dem Kreuz endlich da. Drei Jahre hatte sie aus diesen Tag hingearbeitet und nun war es bald soweit. Es war der Tag ihrer Abschlussprüfung, den sie sich markiert hatte. Das sie bestehen würde daran hatte sie keinerlei Zweifel.
 1x
1x