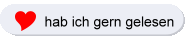Veröffentlicht: 17.10.2019. Rubrik: Menschliches
Die Siedlung
Ich bewohnte seit etwa sieben Monaten einen jener Siebzigerjahre Bauten mit vier Stöcken und zwei Eingängen, die die Peripherie unserer Mittellandstadt zuhauf zierten. Meine elfhundert Franken Wohnung klemmte im dritten Stock zwischen der eines Kettenrauchers und jener einer fünfköpfigen Familie mit doppelt so vielen Katzen, was durch die Geruchsundichte der Deckenwände zu einer charakterisierenden Mischung im Mittelgeschoss führte.
Das Einzigartige an den Siedlungen unserer Art war, dass Eine der Anderen glich; nicht nur wegen der Architektur der Häuser oder ihrer dijonsenf-, mausgrau- oder rosafarbenen Anstrichen, sondern vorwiegend infolge der Stimmungen und Attitüden ihrer Bewohner.
Ich war einer von ihnen. Aber wie kam es, dass mich das Leben mit solch einem Loch abstrafte, wo ich mich täglich einfand mitten in der Geruchswelt von Grilladen, Knoblauch und Katzenkot und einer nicht verstummenden Geräuschkulisse von knarrenden Decken, Streit und Stöhnen?
Als ich im letzten Sommer kurz nach meinem zwanzigsten Geburtstag meine erste Stelle in der Elektronikabteilung eines Kaufhauses annahm, entschied ich mich, den Schutz meines Mutterhauses zu verlassen und auf mich gestellt, das Leben zu versuchen. Ich nahm diese Wohnung, die meinen Ansprüchen genügen musste, kaufte mir im Möbelhaus das Nötigste und trottete nun täglich hin und her zwischen Kaufhaus und Siedlung.
Aus irgendeinem Grund, stellte die neue Wohnung auch ein Bruch mit den alten Bekannten dar. Zwar besuchte ich Mutter noch ab und zu, diese verhielt sich aber zunehmend gleichgültiger mir gegenüber. Die alten Freunde aus der Schule hatten sich ihren eigenen Leben, Interessen oder Karrieren zugewandt.
Da lebte ich also in der Siedlung und wusste mir eines Abends vor lauter Langeweile nicht besser zu helfen, als mir ein Pack Zigaretten zu kaufen und beim Kettenraucher ein Stock tiefer mit Lunte im Maul wegen Feuer anzuklopfen:
„Guten Abend, ich bin der von oben drüber und möchte sie höflichst um Feuer bitten.“
Er schaute mich einige Momente mit grossen, strengen Augen an, zog dann aber ein Feuerzeug aus der Tasche und steckte mir Feuer an. Die Türe knallte zu, ich war aber auch schon im umkehren begriffen, denn es war für uns beide spätestens von dem Moment an, als das Feuer brannte, klar, dass wir uns nichts zu sagen hätten. Qualmend stieg ich wider zu meinem Heim empor, da kamen mir Kinder entgegen; drei an der Zahl; schätzungsweise zwischen zwei und sechs Jahre alt. Beschämt versteckte ich die Zigarette in der Hand und versuchte nett zu sein: „Wohin geht ihr Kinder?“
„Nach draussen...“ Und alle rannten sie.
Dann kamen mir die Eltern ebenfalls rauchend entgegen. Die Mutter musste trotz ihres schmächtigen Wuchses an die 90 Kilo wiegen, was der grosse Vater vermutlich etwa um einen Drittel übertreffen durfte. Ein Hallo gönnten sie mir nicht, aber hinter ihnen her schlich Katzenkotgeruch.
Wieder in der Wohnung versuchte ich mir meiner Situation abermals klarzuwerden. Mein Gefängnis bestand aus einer schimmligen Wohnung ohne Ambiente, aus einer Anstellung ohne Sinn, aus Mitgefangenen, die sich kamelgleich an dem Blut erfreuten, das in ihren Mundhöhlen quoll, wenn sie auf Dornen bissen und aus diesen ewigen Gedanken über die Ausweglosigkeit meiner Situation. Aber war ich eben ein solches Tier, wie alle die hier wohnten oder machte mich mein Urteil über sie zu einem? Jedenfalls, und das bemerkte ich deutlich, begann ich mich langsam ihrer Dekadenz anzupassen, denn die Studie der Siedlung zog mich in ihren Bann...
Parterre wohnte eine alte Witwe, die mir bei diesem Bestreben behilflich sein sollte. Eines Samstagnachmittags als ich gerade von einem Spaziergang nach hause kehrte, begegnete ich ihr an der Haupttür. Sie trug eine volle Wasserhaarasse, was ihr alter Körper ziemlich zu belasten schien. Obwohl Hilfsbereitschaft nicht zu meinen Stärken gehörte, überkam mich Mitleid und nahm sie ihr ab. In ihrer nicht so schlecht aufgeräumten Wohnung unter den Küchentisch gestellt bot sie mich noch zwei solcher Lasten vom Auto herein zu tragen und ich gab nach. Nach getaner Arbeit steckte sie mir einen Fünf-lieber unter. Um nicht unhöflich zu wirken nahm ich an und suchte etwas ungeschickt die Unterhaltung:
„Wie kommt es, dass sie in ihrem Alter noch Auto fahren?“
Die Frage schien sie leicht zu brüskieren: „Ich bin achtundsiebzig also noch in keinem Alter, fahre seit fünfundvierzig Jahren und bin viel sicherer unterwegs als die jungen Möchtegerne mit ihren lauten Karren, alle auf Pump gekauft, von denen wir hier so viele haben.“
Die Alte hatte ein recht faltiges Gesicht, ihre Haut glänzte von Creme, aber alles in allem hatte sie einen klaren Ausdruck. Es wäre möglich gewesen, dass ihr Gesicht in jungen Jahren zwar vielleicht etwas langweilig, aber doch recht hübsch gewesen sein könnte. Ich war etwas zu sehr mit der Musterung der Eindrücke beschäftigt, dass ich fast vergass, das Gespräch weiter zu führen:
„Ich kann mir kein Auto leisten, obwohl ich eine volle Stelle im Kaufhaus bekleide.“
Der Alten schien ich zu gefallen und mich machte ihre Wohnung und ihre Beobachtungen über die Eigentümlichkeiten der Menschen unserer Siedlung neugierig. Sie bot mir Kaffee an und führte mich auf die Terrasse, von wo sie auf das Nachbarhaus zeigte:
„Sehen sie da drüben, da wohnen Leute, die beobachte ich schon lange. Der Vater ist seit Jahren arbeitslos, die Mutter arbeitet in der Wäscherei und der Sohn... der Sohn ist wohl etwa in ihrem alter und fährt das lauteste Auto weit und breit. Ist unser Sozialstaat so gütig zu solchen Schmarotzern? Habe ich mich immer gefragt. Dann eines Tages kam die Tochter an. Stellen sie sich vor, aufgetakelt, geschminkt bis über die Ohren mit einem Typen mit eben so einem Auto.“
Ich war mitten hineingeraten in das Gesabber über diese wüste Welt. Wäre ich nicht schon krank gewesen von ihr, hätte ich es nicht an mich herangelassen. Aber in diesem Fall fühlte sich der ganze Klatsch wie ein Glückstrunk für meine triste Seele an.
Also stachelte ich weiter: „Und ich geh täglich auf Arbeit für Nichts und die Steuern.“
Sie geriet in glücklichste Erregung, setzte endlich Kaffee auf und kam wieder strahlend an: „Sie sind ein guter Junge, hätten wir mehr solche wie sie, wäre es nicht so verdorben hier.“
Ich fühlte mich geschmeichelt und fand, dass die unbehagliche Situation, der wir (sie und ich) uns ausgeliefert fanden, weiterer Beobachtung und Theoretisierung bedürfe:
„Diese Menschen beherrschen ihre Sinne nicht, sind wie Tiere ihren Trieben erlegen, kennen keine Tugend und kein Mass.“ Ich erinnerte mich, als ich so sprach, gerade stark an Mutter und tat es ihr gleich als ich fortfuhr: „Sie sind störrisch, launenhaft, gemein, heuchlerisch und verdrossen. Es interessiert sie fremdes Leid nicht und sie kennen kein Gesetz und keinen Edelmut. Alle sind sie Tiere, die nur Schlafen, Essen und sich Kopulieren und wenn sie darin bedroht werden, greifen sie zur Gewalt. Solche Menschen sagen sich, diese Lust habe ich mir erfüllt, jener Feind habe ich zerstört. Sie fühlen sich als die Kontrollierenden, die Geniesser, die Erfolgreichen, die Starken und Glücklichen. Sie suchen immer mehr Sinnenfreude, werden wütend, wenn sie sie nicht befrieden und suchen wieder mehr, wenn sie erhalten, was sie wollen. Glück wird ihnen nie vergönnt.“
Ihre Mundwinkel zogen sich nach oben, als sie mich mit starrer Begeisterung anblickte und endlich zischte: „Sie sind ein Philosoph und brillanter Beobachter. Gleich erzähle ich ihnen mehr Geschichten aus diesem Hause, aber erst hole ich den Kaffee.“
Als sie in die Küche ging, huschte ich schnell in die Stube, um sie in Augenschein zu nehmen: Ein Fernseher, Klatschhefte auf dem Salontisch, alles recht ordentlich Aufgeräumt und auch nicht stinkig, Rüschchen an den Vorhängen, am Lampenschirm, an der Tischdecke, ein Aquarium, hier ein paar Babuschkapuppen und da die Wand mit Fotos. Darauf war sie zu sehen in jüngeren Jahren, anständig gekleidet mit einem hageren Männchen an der Seite. Kinder hatten sie vermutlich keine; auch keine Enkel demnach. Als ich mich wieder in Richtung Terrasse bewegte, bemerkte ich auf dem Fenstersims einen Feldstecher.
Sie brachte dampfenden Kaffee mit Keksen und konnte es kaum erwarten mir den nächsten Tratsch aufzutischen: „Kennen sie den Mann in der Wohnung über mir,“ sie flüsterte, denn wir befanden uns direkt unter seinem Balkon, „bis vor fünf Jahren, sass er hinter Gittern.“
„Warum?“ Fragte ich neugierig.
Sie bot mich näher an ihren Flüstermund: „Nötigung einer Frau, sie bewohnte die ihre Wohnung, ich meine gar es ist darin passiert.“
Ungläubig wollte ich wissen: „Und warum wohnt der Kerl immer noch da?“
„Es ist seine Eigentumswohnung, sie stand fast ein Jahr leer. Er war zu zwei Jahren verurteilt, wurde wegen guter Führung aber frühzeitig entlassen. Seit her liegt bei mir Pfefferspray unter dem Kopfkissen.“
„Und woher wissen sie das so genau?“
„Sie hat es mir selber erzählt, war danach weg und er auch für ein Jahr...“ Sie nippte am Kaffee: „Von der Familie über ihnen weiss ich nur dass sie einen Sozialbeistand haben, die Eltern arbeitslos und Esssüchtig sind, aber das dürfte ihnen schon selber aufgefallen sein.“
Mir war schlecht. Ich trank den heissen Kaffee in einem Schluck aus und verabschiedete mich schnell und ohne Ausrede.
Als ich die Treppen heraufstieg dröhnte es in meinem Kopf. Ich legte mich hin, mein Geist repetierte die Worte der Witwe und malte sich allerlei Vorstellungen darüber aus. Am Sonntag blieb ich allein, schwor mir mich nicht weiter mit diesem Unfug zu beschäftigen und trank und rauchte zur Ablenkung.